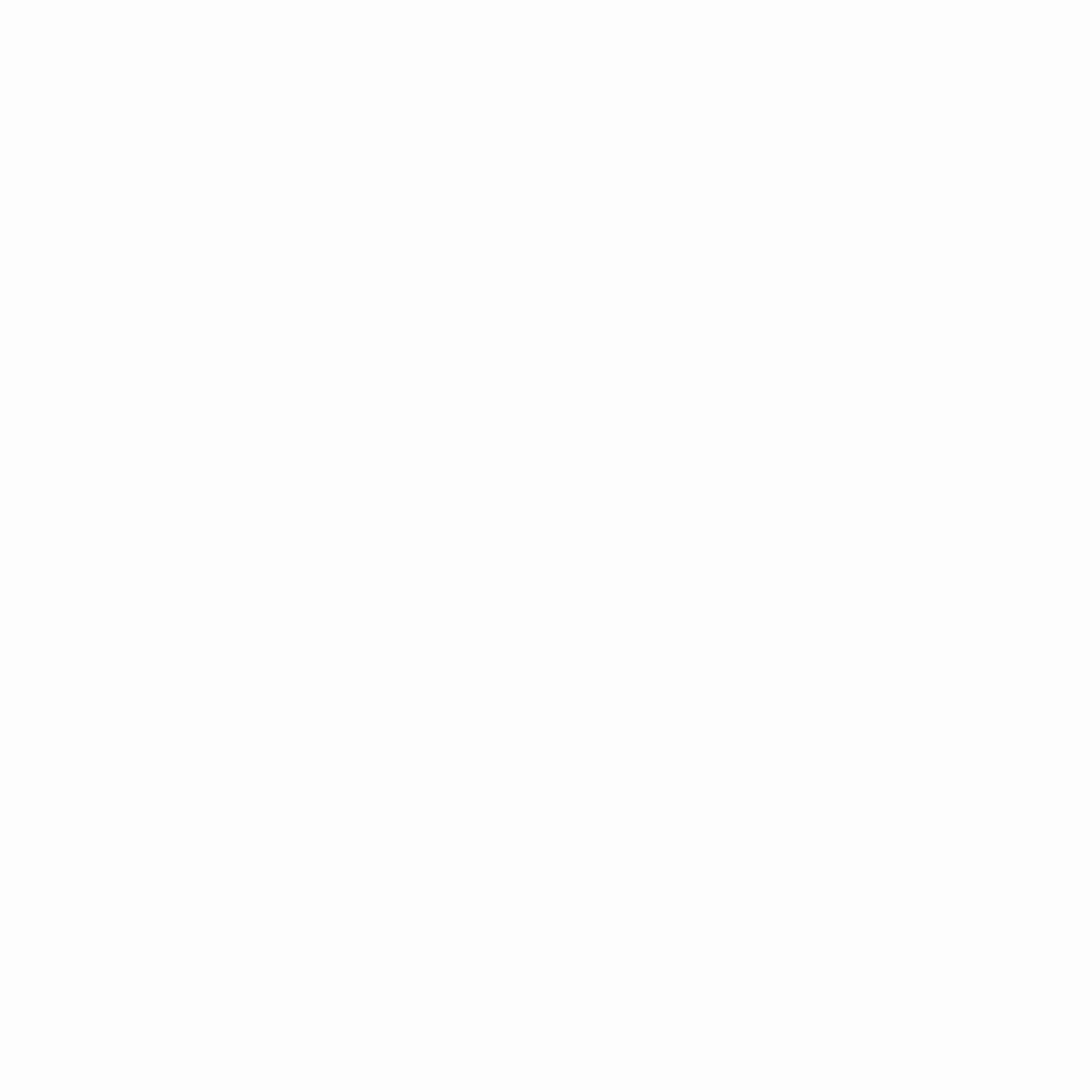Share This Article
Die kapitalistische Industrialisierung und der durch das Kapital geprägte gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur verursachten die Erderhitzung und treiben sie weiter voran. Die planetaren Grenzen der Tragfähigkeit sind teilweise überschritten. Das Erdsystem ist dabei, Kipppunkte zu durchbrechen und damit sich selbstverstärkende Dynamiken auszulösen. Die Erde und die menschliche Gesellschaft bewegen sich in eine neue und bislang völlig unbekannte Situation. Das Erdsystem verändert sich abrupt. Erstmals in der Menschheitsgeschichte verändern sich die physischen Bedingungen des Erdsystems während einer Generation. Noch dramatischer: sie verändern sich schneller als die Gesellschaften lernen und die erforderlichen Schlüsse ziehen.
Die kapitalistische Produktionsweise übernutzt nicht nur die Natur, sondern zuallererst den Menschen, der auch Teil der Natur ist. Stress erzeugende Verhältnisse am Arbeitsplatz, Entfremdung, niedrige Löhne, vielfältige Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen, unhaltbare Wohnbedingungen und erzwungene Mobilität machen den Alltag zum individuellen Kampftag. Die kapitalistische Produktionsweise kann sich nur durch ungleiche Verhältnisse auf allen Ebenen durchsetzen. Eine gerechte Weltwirtschaft unter diesen Bedingungen ist unmöglich. Die Plünderung der Natur, die Ausbeutung der Lohnarbeit, die Kolonisierung reproduktiver Arbeit sowie Imperialismus und rassistische Spaltung sind unzertrennlich in die kapitalistischen Verhältnisse eingewoben. Diese Verhältnisse lassen sich nur gemeinsam aufheben.
Es gibt keine dafür, dass sich die kapitalistische Produktionsweise schrittweise in der gebotenen Zeit so stark reformieren lässt, um die größten gesellschaftlichen Verwerfungen und ökologischen Verwüstungen zu verhindern. Die Grundlagen eines „Green New Deal“ und einer sozialökologischen Transformation brechen schneller weg, als dass sozialökologische Reformschritte überhaupt erkennbar sind.
Die Überwindung dieser Ausbeutungsbedingungen und des zerstörerischen Stoffwechsels mit der Natur erfordert den Bruch mit der Herrschaft des Kapitals. Die hier bloß angedeuteten Widersprüche haben sich derart zugespitzt, dass die Aktualität einer Revolution objektiv immer dringender wird. Doch wenn wir vom Bewusstsein der arbeitenden Menschen, also ihrem Empfinden und Handeln, in den frühindustrialisierten und imperialistischen Ländern ausgehen, dann scheint eine revolutionäre Perspektive nicht mal in weiter Ferne erkennbar zu sein.
Die Herausforderung der Erderhitzung ist umfassend und historisch einmalig. Frühere und mittlerweile historisch überkommene sozialistische Bewegungen trachteten danach, den gesellschaftlich produzierten Reichtum zu erweitern und in Gesellschaftseigentum zu überführen. Jetzt geht es darum, den bestehenden produktiven Apparat komplett um- und teilweise zurückzubauen. Gesellschaftlicher Reichtum darf nicht primär materiell verstanden werden, sondern als Möglichkeit der kulturellen und kreativen Weiterentwicklung und Befreiung. Ökosozialist:innen setzen sich dafür ein, weite Teile des produktiven Apparates, die Organisation der Produktions- und Innovationssysteme und die Strukturen der internationalen Arbeitsteilung komplett umzugestalten. Es gilt, die Treibhausgasemissionen in kürzester Zeit massiv zu reduzieren, ohne gleichzeitig andere ökologische Zerstörungen hervorzurufen und soziale Verelendungsprozesse auszulösen (Zeller 2020).
Wir haben in dieser ersten Ausgabe von emanzipation nach unserer mehrjährigen Pause Diskussionsbeiträge versammelt, die sich mit genau diesen Spannungsfeldern eines ökosozialistischen revolutionären Prozesses auseinandersetzen.
Neil Faulkner zeigt anhand der Entwicklung in den letzten beiden Jahrzehnten, dass Revolutionen möglich sind. Zudem sind die objektiven Bedingungen für eine Überwindung der Herrschaft des Kapitals gegeben. Doch keiner revolutionären Bewegung ist es gelungen, gestützt auf eigene Organe die Machtfrage zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. Die subjektive Voraussetzung fehlt: ein internationales Netzwerk von sozialistischen Revolutionär:innen, die eine Vision von direkter Demokratie, ökosozialistischer Revolution und einer veränderten Welt verkörpern. David McNally verweist auf neue Formen des Reformismus mit seinen unrealistischen Annahmen, bekräftigt das Konzept der Doppelmacht und kritisiert die Staatstheorien, mit denen eine Reformstrategie begründet wird. Schließlich unterstreichen doch die Massenbewegung und revolutionären Erhebungen der letzten beiden Jahrzehnte die Möglichkeiten radikaler Brüche. Gareth Dale, Amanda Armstrong Price, Lucí Cavallero und Adam Hanieh knüpfen direkt hier an. Sie lassen sich in ihrer gemeinsamen Diskussion durch die Argumente von David McNally sowie das von Dale, Barker und Davidson (2021) herausgegebene Buch Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Age inspirieren. Anhand von jüngeren Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen der Welt fragen sie, welche Verläufe revolutionäre Prozesse nehmen können und welche die Gründe für ihre Niederlagen waren.
Der zweite Themenblock des Heftes zielt auf eine Synthese von Ökosozialismus und Degrowth. Michael Löwy, Bengi Akbulut, Sabrina Fernandes und Giorgos Kallis benennen in ihrem Diskussionsbeitrag, wo sich ökosozialistische Kräfte und Degrowth-Anhänger:innen treffen und wie sie eine gemeinsame Grundlage entwickeln können. Jess Spear und Paul Murphy argumentieren in dieselbe Richtung und unterbreiten zugleich praktische Vorschläge, wie Ökosozialist:innen die Orientierung auf eine Wachstumsrücknahme in politischen Auseinandersetzungen im Sinne der Interessen der Lohnabhängigen einbringen können. Daniel Tanuro zeigt, wie das Wachstum nicht nur mit der Natur kollidiert, sondern dass es auch ungerecht ist. Eine gerechte und breit abgestützte ökosozialistische Wachstumsrücknahme ist nicht nur erforderlich, sondern auch praktisch möglich.
Der dritte Themenbereich dreht sich um das Spannungsfeld, wie die physischen Veränderungen des Erdsystems und die gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängen. Daniel Tanuro weist darauf hin, dass die Berichte des Weltklimarats IPCC eigentlich Aufrufe zur Revolution sind. Denn die erforderliche Reduktion der Treibhausgasemissionen lässt sich nur durch eine komplette Überwindung und Zerschlagung des gesamten fossilen Sektors erreichen. Die Forderungen des IPCC stehen im Widerspruch zu einer Fortsetzung der Wachstumslogik und damit zur Akkumulation von Kapital.
Christian Zeller knüpft an den Befunden des IPCC an und argumentiert, dass und wie sich das Überschreiten von Kipppunkten im Erdsystem, die Vielzahl der gesellschaftlichen Krisen und die Zuspitzung imperialistischer Rivalität in Kriegen zu gesellschaftlichen Kipppunkten verdichten. Reformstrategien haben buchstäblich ihre Grundlagen verloren, weil sich die physischen und gesellschaftlichen Bedingungen so schnell und abrupt verändern, dass Reformen fortlaufend der Boden unter den Füßen wegbricht. Darum sind Ökosozialist:innen gefordert, transnationale revolutionäre Strategien zu entwickeln, die konkrete Antworten auf lokaler, regionaler, nationaler, transnationaler, kontinentaler und globaler Ebene geben. Diana O’Dwyer nimmt sich der offensichtlichen strategischen Lücke an. Sie unterbreitet konkrete Vorschläge, auf welchen thematischen Achsen ökosozialistische Kräfte strategisch in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen eingreifen und wie sie in den unmittelbaren täglichen Konflikten ihren Einfluss ausbauen können. Entscheidend ist es, die Verantwortung der Arbeitenden für die konkrete Organisation des Arbeitsprozesses ins Blickfeld zu nehmen, vor allem in den Schlüsselsektoren der Wirtschaft.
Der Ökonom François Chesnais zeichnet ein umfassendes Bild vom Zustand des globalen Kapitalismus. Die kapitalistische Wirtschaft rutscht in ein schwaches Wachstumsregime ab, das durch geringe Produktivitätszuwächse, hohe Inflation, chronische finanzielle Instabilität und erhebliche Knappheitsphänomene gekennzeichnet ist. Darum werden die besitzenden Klassen wahrscheinlich den Druck auf die Arbeitenden und die Umwelt erhöhen und die Ausbeutung verschärfen. Chesnais zeigt, dass die wirtschaftlichen Spielräume für sozialökologische Reformen nicht existieren.
Wir haben auch die traurige Nachricht anzufügen, dass zwei unserer Autoren verstorben sind. Neil Faulkner verstarb am 4. Februar 2022 im Alter von 64 Jahren, also nur wenige Wochen nachdem sein Aufsatz auf Englisch auf der Webseite von Anticapitalist Resistance am 31. Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die von uns veröffentlichte Analyse von François Chesnais über die gegenwärtige Konfiguration des Kapitalismus ist leider auch einer seiner letzten längeren Texte. François Chesnais verstarb am 22. Oktober 2022 im Alter von 88 Jahren. Neil Faulkner und François Chesnais haben rastlos dazu beigetragen, die Kritik der Kapitalherrschaft und die Suche nach radikalen ökosozialistischen Alternativen immer wieder neu zu fundieren, den sich verändernden Bedingungen anzupassen und damit lebendig zu halten.
Christian Zeller
Literatur & Referenzen
Covergestaltung: Basierend auf einem Bild von Lucas K auf Unsplash
Dale, Gareth; Barker, Colin und Davidson, Neil (Hrsg) (2021): Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Age. Chicago: Haymarket Books, 448 S.
Zeller, Christian (2020): Revolution für das Klima. Warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen. München: Oekom Verlag, 248 S.