Share This Article
Welche Rolle können ökosozialistische Ideen für Gewerkschaften, Parteien, Genossenschaften, in sozialen Bewegungen und Basisorganisationen spielen? Der Artikel fragt nach Tendenzen und Chancen verbindender Organisierung.
1. Einleitung
In der Alten Linken, der Arbeiter:innenbewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, war die Rede von drei Säulen – der Gewerkschaft, der Genossenschaft und der Partei – auf denen die Gesamtbewegung ruht. War die Gewerkschaft für die Arbeitswelt zuständig, so die Partei für den politischen Kampf und die Genossenschaften für die Alltagswelt. Linksradikale opponierten im 20. Jahrhundert gegen diese Formen und setzten auf Betriebs-, Bewegungs- und Basisorganisationen, die Betriebe, Straßenproteste und Stadtteile zum Ausgangspunkt nahmen. Es ergibt sich also eine klassische Gegenüberstellung, wie in Abbildung 1 dargestellt.
Was bedeutet diese Aufteilung, die für autoritäre wie libertäre sozialistische Ansätze galt, für ökosozialistische Praxis heute?
Die Vielfalt möglicher Organisationsformen korrespondiert in diesem Beitrag mit einem breiten Begriff von Ökosozialismus. Zwei kurze Beispiele, um diese Breite zu verdeutlichen. Laut dem libertären Ökosozialisten Murry Bookchin (1921-2006) sollten sich „Anarchist_innen und Ökosozialist_innen […] für öffentliche Ämter der Gemeinden kandidieren, […] sie kandidieren auch gegen den Staat und gegen parlamentarische Behörden“ (Bookchin 1992: 63). Dieser Kommunalismus ist in der US-Tradition beheimatet. Der autoritäre Ökosozialist Wolfgang Harich (1923-1995) hingegen setzt auf den Staat als Instrument.

Bildzitat aus Neupert-Doppler (2021): Organisation, Schmetterling, S. 21.
„Der proletarische Staat muß […] über die Machtmittel verfügen, auch den Konsum der Individuen zu kontrollieren, und zwar nach Kriterien, die ihm die Ökologie an die Hand gibt“ (Harich 1975: 179). Sein Vorbild: Der Etatismus der SU (Sowjetunion). In vielen westeuropäischen Ländern entwickelten sich in den 1980er Jahren demokratische und feministische Ökosozialismen, die als Minderheiten politische Heimat bei den Grünen und in der Sozialdemokratie fanden. Was ist nun aber der Ökosozialismus?
Ökosozialismus als Utopie zu verstehen, als Möglichkeitsraum, erlaubt es diese Frage zurückzuweisen. Ausgehend von meinem funktionalen Utopiebegriff, den ich seit 2015 entwickele, ist es möglich, dennoch gemeinsame Tendenzen diverser (libertärer, demokratischer, autoritärer) Ökosozialismen zu fassen (Abbildung 2).
Hinsichtlich der kritischen Negation besteht weitgehende Einigkeit zwischen den ökosozialistischen Strömungen: Die Produktions-, Reproduktions- und Konsumweise des Kapitalismus wird als Ursache ökologischer Probleme begriffen. Für die bewusste Intention ihrer Theoriebildungen gilt: Anders als beim Ökokonservatismus oder Ökoliberalismus ist Achtung vor der Natur (Bewahrung der Schöpfung, Naturschutzgebiete) ebenso unzureichend wie die bloße Anerkennung von Regulierungsbedarf innerhalb einer marktwirtschaftlichen Ökonomie. Ökosozialismen zielen auf die Aneignung und Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, ob nun durch Betriebsbesetzung, Genossenschaftsgründung oder Verstaatlichung. In ökosozialistischen Zukunftsentwürfen kommen Bedürfnisse nach Gesundheit und gutem Leben zur Artikulation, was auch eine Motivation zum Handeln ausmacht.
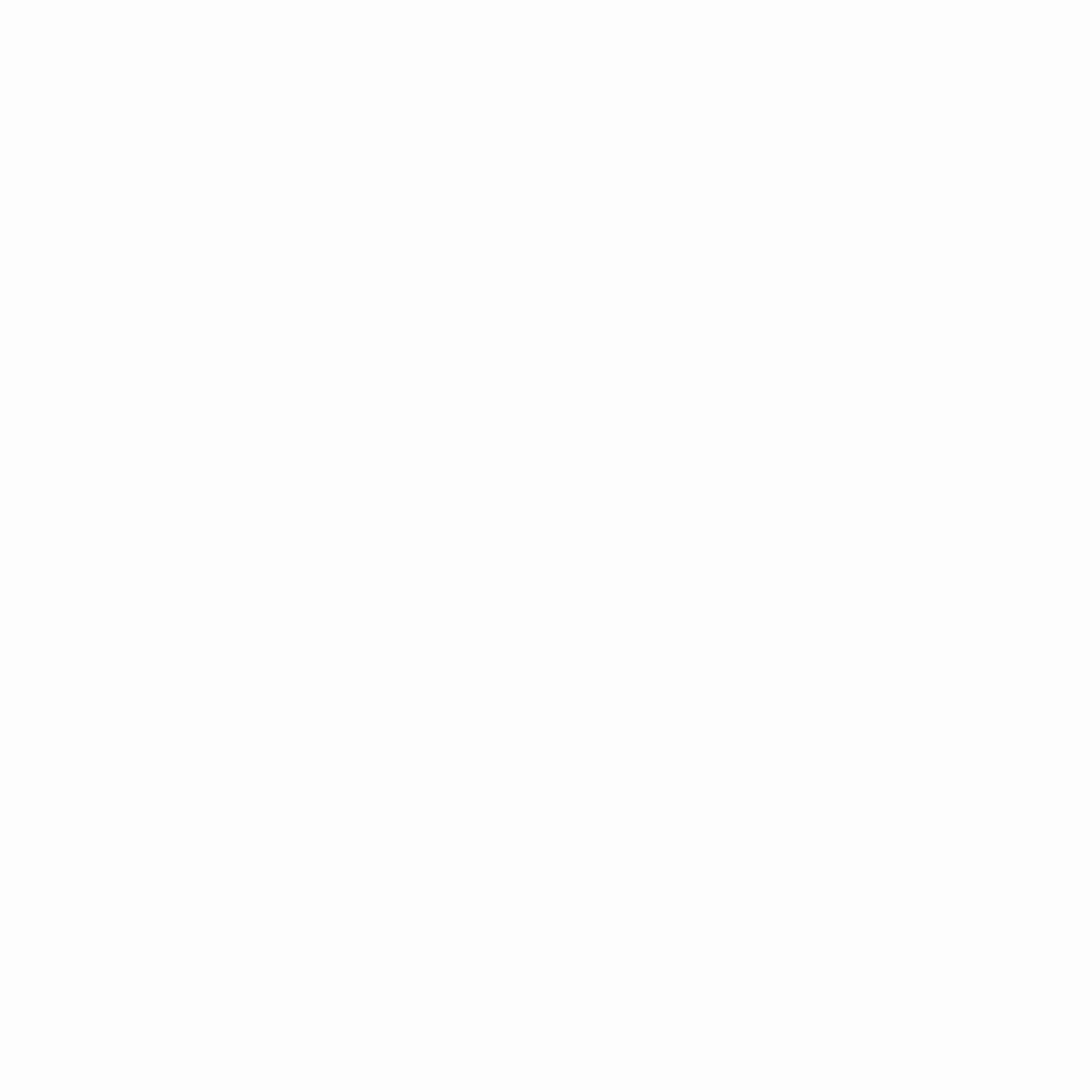
Bildzitat aus Neupert-Doppler (2022): Ökosozialismus, Mandelbaum, S. 11.
Die größten Unterschiede bestehen bei der Konkretion des Möglichen, vor allem hinsichtlich der Fragen von Technik, Ökonomie und Politik.
Der Ökosozialist Saral Sarkar (2001) setzt z.B. für eine andere Gesellschaft auf mehr menschliche Arbeitskraft statt Computer, der Ökosozialist Klaus Engert (2010) auf mehr Digitalisierung. Der Ökosozialist Elmar Altvater (1996) hält Marktwirtschaft für nötig, der Ökosozialist Bruno Kern (2019) betont die Planwirtschaft. So sehr Eckpunkte einer geteilten Utopie erkennbar sind – die oben genannten verwende ich als kleinsten gemeinsamen Nenner der Tendenz – so sehr unterscheiden sich die Wege zum ökosozialistischen Horizont. Dies gilt, wie seit jeher im Sozialismus als politischer Pol, auch für den Ökosozialismus als entstehende Polarisierung. Im Folgenden geht es um folgende Leitfragen: Parteiorganisation oder Bewegung (1.)? Welche Rolle können Gewerkschaften und Betriebsorganisationen spielen (2.)? Was tragen Genossenschaften bzw. lokale Basisorganisationen bei (3.)?
2. Partei und Bewegungspolitik
Zur Parteifrage finden wir im Feld der Ökosozialismen drei grundlegende Antworten. ‘Keine Partei’ im Ökoanarchismus, ‘Neue Partei’ bei grünen Ökosozialist:innen oder ein nur taktisches Verhältnis. Bookchin, der wohl weltweit bekannteste libertäre Ökosozialist, lehnte als Anarchist Parteigründungen ab. Am Beispiel der deutschen Grünen betont Bookchin in den 1990ern: „Der Verfall der deutschen Grünen – der sogenannten ‚Partei, die keine ist‘, die, nachdem sie einen Platz im Bundestag erhielt, mittlerweile zu einer rücksichtslosen politischen Maschine geworden sind – zeigt in eindrucksvoller Weise, dass Macht gewaltig korrumpiert“ (Bookchin 1992: 60). Noch bevor in der rot-grünen Koalition 1998 bis 2005 die Gründungsgrundsätze der bundesdeutschen Grünen geopfert wurden, erkannte Bookchin wie sich die Partei veränderte. Ökologie wurde nicht im Sinne einer konfrontativen Politik interpretiert, angestrebt wurde ein Konsens mit der Industrie, was z.B. beim späteren Atomkonsens 2000 zu längeren Laufzeiten führte. Sozial sind die deutschen Grünen spätestens seit der Einführung von Hartz IV 2005 nicht mehr zu nennen. Gewaltfreiheit im Sinne des Pazifismus gaben die Grünen 1999 mit der Unterstützung des NATO-Krieges gegen Rest-Jugoslawien auf. Die Bedingung all dieser Kehrtwenden war freilich die Abkehr vom Konzept der Basisdemokratie. Jutta Ditfurth, die bis 1988 noch eine Bundesvorsitzende war, aber 1991 austrat, erinnert an den hohen Anspruch dieser Idee. „Keine Partei, auch keine linke, besaß demokratische Strukturen wie diese neuen Grünen: Trennung von Amt und Mandat, Rotation, kein Abgeordnetengehalt höher als ein Facharbeitergehalt, also Abgabe von Diäten. […] Es ist ein Mythos, dass diese basisdemokratischen Strukturen später abgeschafft werden mussten, weil sie die politische Arbeit störten. Sie wurden beseitigt, weil sie wirkten und weil sie die KarrieristInnen behinderten“ (Ditfurth 2011: 64).
Keine Häufung von Parteiämtern und Parlamentsmandat, kein dauerhafter Verbleib im Parlament sondern Rotationsprinzip, keine persönliche Absicherung durch Diäten und ähnliche Maßnahmen hatten letztlich ein Ziel: Zu verhindern, dass sich grüne Abgeordnete in Berufspolitiker:innen verwandeln. Nur Menschen, die sich von ihren Positionen lösen können, sind konfliktfähig und entgehen der ‘Klebrigkeit der Institutionen’ (Agnoli). Als zum Beispiel die SPD im ersten rot-grünen Senat in Berlin, der ab 1988 bestand, die Räumung besetzter Häuser veranlasste, beendeten die Grünen die Koalition. Als 2023 die Besetzung von Lützerath geräumt wurde, blieben die grünen Minister:innen in ihren Ämtern und setzen die Koalition fort.
Sicherlich sind es, wie Ditfurth sagt, individuelle Karrieren, die Berufspolitiker:innen nicht aufs Spiel setzen wollen. Die Karte, mit der sie trumpfen können, ist die Bedeutung von Politik-Stars im medialen Wahlkampfspektakel. Die Frage wäre: Können wir Wählende voraussetzen, die auf Inhalte achten? Sicherlich ein hoher Anspruch, der kurzfristig Stimmen kosten mag, aber wenn es mittel- und langfristig um Emanzipation gehen soll und nicht nur um Repräsentation, bleibt er gesetzt. Strukturell wird die Frage parlamentarischer Politik noch erschwert durch den Fetischcharakter staatlicher Institutionen. Gegenüber der gesellschaftlichen Ungleichheit erscheint und wirkt bürgerliches Recht zumindest als formale Gleichheit, angesichts der sozialen Herrschaftsverhältnisse erscheint und wirkt die formale Gleichheit beim Wahlrecht als Korrektiv, angesichts allgemeiner Konkurrenz erscheint und wirkt der Staat als Friedensbringer und Ordnungsinstanz im Chaos.[1] Zugleich hält der Staat das Recht auf Privateigentum aufrecht, reduziert Politik auf Wahlen und sichert Kapitalverwertung ab.
Sollte also auf jede Parteipolitik verzichtet werden, weil der Parlaments- und Regierungsbetrieb individuell korrumpiert (Bookchin 1992, Ditfurth 2011), wenn keine Abhilfe besteht, und Parteien dem Staatsfetischismus erliegen (Neupert 2013)? Aus der Enttäuschung heraus scheint dieser Schluss naheliegend. Luisa Neubauer, selbst Grünen-Mitglied, in 2022: „Wenn es jemals die Illusion gab, dass sich das mit dem Klima schon klärt, sobald die Richtigen regieren, dann liegt sie jetzt in Scherben“.[2] Andererseits muss auch zugestanden werden: Wenn Nicht-Wählen etwas ändern würde, wäre es verboten. Enttäuschung kann auch produktiv werden, wenn wir erkennen, was im Rahmen von Parteipolitik möglich ist und was nicht.
Strukturell bleibt parlamentarische Politik eine im Staat und somit der Rechts-, Politik- und Staatsform verpflichtet. Zugleich ergeben sich der Inhalt von Gesetzen, die Zielrichtung von Maßnahmen und das Ausmaß nationaler Abschottung ebenso wenig aus allgemeinen Formbestimmungen des Staates wie konkrete Löhne aus der Abstraktion der Warenform menschlicher Arbeit Ditfurth betonte daher bereits in den 1980ern den Zusammenhang zwischen Bewegungs- und Parteipolitik. „Meine Konzeption ist: Gesellschaftliche Gegenmacht aufbauen, es gibt nie eine Veränderung politischer Mehrheiten in den Parlamenten, dort drücken sie sich allenfalls aus“ (Ditfurth 1987: 285).
Der Aufbau von Gegenmacht durch Bewegungen benötigt allerdings rechtliche Rahmenbedingungen, demokratische Teilhabemöglichkeiten und gegebenenfalls auch staatliche Unterstützung. Entscheidend sind etwa das Versammlungs- und Polizeirecht, Politische Bildung wie sie Parteistiftungen finanzieren und Informationen aus dem Inneren der staatlichen Apparate. Hierfür braucht es Parteien. Auch wer auf Bewegung setzt sollte einsehen, dass Grundrechte, Gelder und Geheimnisaufdeckung, um die es in der Politik geht, bedeutsam sind.
Wie wäre das Verhältnis von Partei und Bewegung passend dafür zu gestalten? Die alte grüne Konzeption der Bewegungspartei, mit außerparlamentarischem Standbein und parlamentarischem Spielbein, ist gescheitert. Dies liegt auch daran, dass Bewegungen Konjunkturen unterliegen, während Parteien in der Lage sind, Ressourcen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Lädt die Partei Die Linke (PDL) zum jährlichen Bewegungsratschlag mit Deutsche Wohnen enteignen (DWE), Ende Gelände (EG), Fridays for Future (FFF), dem Frauenstreikbündnis 8. März (8M) oder der Seebrücke (SB), so ist automatisch ein Ungleichgewicht gegeben. DWE gibt es seit 2018, ebenso FFF und SB. EG ist seit 2015 aktiv, 8M gewinnt vor allem in den letzten Jahren an Bedeutung. Auch wenn also die Bewegungen schärfere soziale, ökologische, antirassistische und feministische Positionen vertreten als die Partei – und auch weiterreichende Utopien haben – sind ihre Machtressourcen, ob hinsichtlich von Beteiligten, Geld oder Einfluss, geringer. Um von Ratschlägen auf Augenhöhe zwischen Partei- und Bewegungs-Linken zu reden, braucht es Bewegungsorganisationen, die themenübergreifend sind. Von größeren Versuchen wie attac (29.000 Mitglieder in der BRD, 5.500 in Österreich) über kleinere wie die Interventionistische Linke IL (ca. 1.000 in der BRD und Österreich) bis hin zu kleinsten wie dem Bündnis Ums Ganze UG (einige hundert) existiert ein Spektrum von Bewegungsorganisationen, die ähnlich kontinuierlich sind wie die PDL (Gründung 2007): attac arbeitet seit 1998, die IL seit 2005, UG seit 2006.
Sicherlich sagen abstrakte Mitgliedszahlen noch nicht viel über die konkrete Handlungsmacht von Organisationen aus. Dennoch liegt auf der Hand, dass von tatsächlicher Gegenmacht noch nicht die Rede sein kann. Beim System-Change-Camp in Hannover 2023 wurde daher vereinbart, eine eingreifende, kapitalismuskritische Klimabewegungsorganisation zu gründen. An diesem Prozess sind Akteure von EG und FFF, von IL wie UG beteiligt. Ob damit neben den protestierenden FFF und der aktivistischen Letzten Generation ein linker Ansatz entsteht?
Mit der Gründung einer verbindenden Bewegungsorganisation, für die im Oktober 2023 in Göttingen eine Konferenz geplant ist, ist die Parteifrage in der ökosozialistischen Debatte nicht gelöst.
Kann die PDL die Grünen, die sich von ihrem ökosozialistischen Flügel aus den 1980ern in den 1990ern trennten, um sich dem Ökoliberalismus zuzuwenden, als ökosozialistische Bündnispartnerin in der BRD ersetzen?
Deren Ökologische Plattform, 1994 in der PDS entstanden, veröffentlichte die Ökologische Plattform 2006 ihr Ökosozialistisches Manifest.[3] Könnte diese Plattform, zumal wenn sich das innerparteiliche Kräfteverhältnis durch den Austritt der russophilen und sozialkonservativen Strömung um Wagenknecht verschiebt, an Einfluss gewinnen? Oder braucht es eine neue Partei, möglicherweise mit Rückgriff auf die basisdemokratische Tradition der frühen Grünen?
Christian Zeller scheint dies nahezulegen. „Die sozial-demokratischen Parteien werden nicht in der Lage sein, eine der gesellschaftlichen und sozialen Situation angemessene programmatische Grundlage zu erarbeiten“ (Zeller 2020: 47). Weiterhin: „Die kommunistischen Parteien haben bis heute das Desaster des Stalinismus nicht aufgearbeitet“ (ebd.). Schließlich: „Auch die Grünen Parteien […] haben sich längst einer Modernisierung des Kapitalismus verschrieben“ (ebd.: 48). Insofern die Klimakrise mit einer Demokratiekrise einhergeht, könnte es auch einen Kairós, eine historische Gelegenheit,[4] zur Konstitution von Organisationen geben, wenn die Kräftekonstellation passt. Ist die sozial-ökologische Krise als objektive Bedingung einer solchen Kairós gegeben, so fehlt bisher eine geeignete Konstellation, um konstituierende Macht zu entfalten. Zeller spricht von „Selbstkonstitution […] neuer politischer und gesellschaftlicher Organisationen und Bewegungen, einschließlich neuer Parteien“ (ebd.: 208).
Dass es besser aufgestellte Bewegungsorganisationen braucht, die überhaupt Parteiorganisationen auf Augenhöhe entgegentreten können, wurde bereits deutlich gemacht. Abzuraten ist dabei von reinen Ein-Punkt-Bewegungen bzw. -Organisationen. Antirassismus, Feminismus, soziale Fragen und Ökologie sind wichtig, aber „das Problem dieser Bewegungen besteht darin, daß sie als Einpunktbewegungen begrifflich zu schwach sind; sie bedürfen einer ebenso negativen gesamtgesellschaftlichen Begründung und Zielsetzung, die nur in einer radikalen Kritik der fetischistischen Wertvergesellschaftung bestehen kann“ (Kurz 2003: 109f.). Migration ist nicht von Klimaflucht zu trennen, Feminismus nicht von den Belastungen die in Krisenzeiten auf FLINTA (FrauenLesbenInter-, Trans und Asexuelle) zukommen. Ökologie gelingt nicht mit ökoliberaler Marktregulation, sondern nur mit der Veränderung von Eigentums-, Produktions- und Distributionsverhältnissen. Klimaerhitzung ist kein Haupt-, aber ein Grundwiderspruch.
Abgesehen von der inhaltlichen Beschränktheit bei Einpunktbewegungen spricht auch aus der Perspektive des Internationalismus Alles dafür, sich multithematisch aufzustellen. Für Bewegungsorganisationen ist es ohnehin sehr schwierig, auf globaler Ebene Bündnispartner:innen zu finden – verkomplizieren wir die Lage nicht, indem wir im deutschsprachigen Raum die Anzahl der Bewegungs-Organisationen unnötig in die Höhe treiben!
Lassen sich, um beim bundesdeutschen Beispiel zu bleiben, bei SPD, Grünen und Linkspartei – wobei letztere hinsichtlich ihrer Strömungen, nämlich Bewegungslinke, Reformer:innen, Zentristen und Sozialkonservative[5], differenziert zu betrachten ist – noch Anknüpfungspunkte finden? Lässt sich aus früheren Fehlern lernen?
In der SPD gab es in den 1980er Jahren auch Ökosozialist*innen. Wie schwach die Kapitalismuskritik dieser Strömung war, lässt sich auch am Rückblick der heute noch aktiven Protagonist:innen aufzeigen. So schreibt Klaus-Jürgen Scherer 2023 in ‘Ökosozialismus – Keine neue Debatte, aber von neuer Aktualität’ gegen klassische Sozialismus-Utopien über „die längst überholte Vorstellung, Sozialismus sei die Enteignung aller Produktionsmittelbesitzer, die Abschaffung jeglicher Marktwirtschaft und zentralistische staatliche Planung“ (Scherer 2023: 54). Angesichts des CO2-Ausstoßes, den Energie- und Industriekonzerne verursachen, ist auf Enteignung zu verzichten bereits eine Kapitulation. Favorisiert wird im sozialdemokratischen Ökosozialismus stattdessen „eine Wirtschaft, die auf […] Rahmenplanung und Steuerung basiert“ (ebd.: 52).
Sakrosankt bleibt der Markt, der lediglich regulierend gerahmt und durch Anreize gesteuert werden soll. Ein solches Programm des Ökoliberalismus ist jedoch in mehrfacher Hinsicht unzureichend. Gegenüber den systemischen Zwängen von Profitorientierung und Konkurrenz, die Umweltpolitik immer als Standortnachteil erscheinen lassen, bleibt dieser Ansatz ebenso unkritisch wie gegenüber dem Konsumismus, der als Kompensation für entfremdete Arbeit eine weit verbreitete Lebensform darstellt. Um eine Systemalternative geht es in der Sozialdemokratie nicht. Dem entsprechend ist es Scherer auch egal, „ob man eine solche radikale Reformstrategie der demokratischen, sozialen und nachhaltigen Richtungsänderung dann letztlich aufgeklärten Kapitalismus, sozial-ökologische Marktwirtschaft, Postwachstumsgesellschaft, ökologische Disruption, Post-Kapitalismus, Demokratischen Sozialismus oder gar Ökosozialismus nennt“ (ebd.: 55). Zwischen aufgeklärtem Kapitalismus und Post-Kapitalismus, Marktwirtschaft und Postwachstumsgesellschaft sieht Scherer keine Widersprüche.
Bei den deutschen Grünen ist kein ökosozialistischer Flügel erkennbar. Nichts ist übrig geblieben von den Programmen der 1980er: „Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel und Banken sollen in neue gesellschaftliche Formen des Eigentums überführt werden […] Eine Wirtschaftsordnung mit selbstverwalteten Betrieben ohne hierarchische Strukturen muß gewährleisten, daß die betrieblichen Entscheidungen den gesamtgesellschaftlichen Interessen in sozialer und ökologischer Hinsicht gerecht werden. […] Wir Grünen wissen, dass eine basisdemokratische Wirtschaftsordnung sich nur von unten her entwickeln kann“ (Die Grünen, Sindelfinger Programm, zit. n. Ebermann/Trampert 1984: 274).
Allenfalls in den Jugendorganisationen finden sich noch Anklänge, ähnlich wie bei Kevin Kühnert, der 2019 als Juso-Vorsitzender erklärte: „Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar“.[6] Im selben Jahr sagte die Vorsitzende der Grünen Jugend Deutschland Anna Peters: „Kapitalismuskritik und ganz generell die Kritik daran, dass wir im Moment zu Lasten unserer Umwelt, aber auch zu Lasten von vielen Menschen wirtschaften, ist immens wichtig. Nur wenn wir diese Probleme benennen, können wir daran etwas ändern. Wir als Grüne Jugend fühlen uns dem linken Parteiflügel der Grünen da ja sehr nahe, gehen allerdings noch einen Schritt weiter“.[7] Was Kühnert und Peters als Jugendvorsitzende formulieren, findet sich nicht in den Fraktionen. Zwar ist es erfreulich, wenn die Studierendenorganisation CampusGrün in Hamburg über ‘Wege zum Ökosozialismus’[8] redet, dies kann aber Jugendsünde bleiben.
Wenn in der PDL und der Rosa-Luxemburg-Stifung über Ökosozialismus zumindest geredet wird, so wäre der Schluss, dass wir es hier bereits mit einer gut organisierten ökosozialistischen Strömung in der Partei zu tun zu haben, verfrüht. Ebenso falsch wäre aber der Umkehrschluss, es sei an der Zeit, eine neue Partei mit antirassistisch-feministischem Anspruch und öko-sozialistischem Programm zu gründen. Dagegen sprechen vier Argumente, die mit gegebenen Kräftekonstallationen, Wahlchancen, Bewegungsydynamiken und Ressourcen zu tun haben.
Erstens würde eine ökosozialistische Parteigründung in der BRD, anders als die Gründung der sozialökologischen Grünen 1980, die im Kontext von Anti-Atom- und Frauen-, Friedens- und Alternativbewegung geschah, nicht in einem Moment der gefühlten Offensive stattfinden. Zwar konnten EG und FFF das Thema Kohleausstieg in die Debatte bringen, sie bleiben aber gegenüber dem Ökoliberalismus der Ampelkoalition machtlos. Zwar zeigte die Enteignungs-Kampagne von DWE in Berlin, dass es Mehrheiten für linke Politik geben kann, aber der Neoliberalismus auf dem Wohnungsmarkt ist ungebrochen. Proteste von pro-migrantischen Bewegungen wie der Seebrücke sind angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus in der Defensive. Zweitens wären die Wahlchancen bei möglicherweise fünf als ‘links’ wahrgenommen Parteien – Wagenknecht-Partei, SPD, Grüne, PDL und eine neue ökosozialistische Partei – absehbar schlecht. Drittens könnte eine Parteigründung, ähnlich wie schon 1980, zu überzogenen Erwartungen führen, was Bewegungen lähmt. Viertens würde der Aufbau eines entsprechenden Apparates viele Ressourcen in Anspruch nehmen, während Gelder und Ressourcen verlorengehen, wenn mit der PDL auch die Rosa- Luxemburg-Stiftung in der Versenkung zu verschwinden droht.
Was aber ist die Alternative, wenn es für eine reine Protestbewegung zu spät und für Parteigründungen zu früh ist?
Angesichts der Situation bei SPD und Grünen, wo entweder ein flauer Begriff von Ökosozialismus verbreitet wird (Scherer 2023) oder Genoss:innen sich dazu nur im Kontext der Parteijugend äußern (Kühnert 2019, Peters 2019), bleibt für die BRD vorerst nur eine taktische Orientierung auf die Linkspartei. Kommt es 2023 zu einer Abspaltung der Sozialkonservativen mit einem Teil der Zentristen von der PDL, die dann nur noch aus den Strömungen der Bewegungs- und Reform-Linken bestünde, wäre die Gründung einer fünften Partei, links von Wagenknecht, SPD, Grünen und Rest-Linkspartei eher ein Zeichen von Zersplitterung denn einer Kräftebündelung.
In welcher Form eine ökosozialistische Bewegung parlamentarische Wirkmacht entfalten kann ist eine nachgeordnete Frage gegenüber dem Problem, überhaupt erst einmal gesellschaftliche Diskurs- und Interventionsmacht aufzubauen. Ein taktisches Verhältnis zur Linkspartei als Wechselwirkung – inhaltliche Impulse geben, finanzielle Bildungsmittel nehmen, für eine ökosozialistische Linke eintreten – setzt voraus, dass überhaupt erst einmal außerparlamentarischer Druck aufgebaut wird. Sicherlich sollten sich Ökosozialist:innen in sozialdemokratischen, grünen und linken Parteien um Sichtbarkeit und Einfluss bemühen, für Ökosozialist:innen in der Klimagerechtigkeitsbewegung ist aber der Aufbau von Verbindungen in die betriebliche und lokale Öffentlichkeit momentan wichtiger. Auf der Grundlage dieses Befunds stellt sich die Frage, welche Ansatzpunkte sich aus der Organisationsformentheorie und den ökosozialistischen Debatten ergeben?
3. Gewerkschaften und Betriebsorganisationen
Zur Gewerkschaftsfrage finden sich, ähnlich wie zur Parteifrage, drei Positionen in der Ideengeschichte des Ökosozialismus.
Frühe (autoritäre) Ökosozialist:innen wie Wolfgang Harich (1923-1995) gingen davon aus, dass Gewerkschaften „keine andere Aufgabe kennen, als sich im Rahmen des bestehenden kapitalistischen Systems für die unmittelbaren materiellen Interessen der Arbeiter und Angestellten, für die Verbesserung ihres Lebensstandards, für höhere Löhne, menschlichere Arbeitsbedingungen, Kündigungsschutz usw. einzusetzen“ (Harich 1975: 113). Über den Kapitalismus hinausweisende Fragen nach Zukunftsinteressen, qualitativen Bedürfnissen und dem Sinn der hergestellten Produkte wären ausgeschlossen. Frühe (libertäre) Ökosozialist:innen wie Murray Bookchin gingen hingegen davon aus, es seien Betriebsorganisationen denkbar, die sich weitreichendere Ziele vornehmen könnten. „Nichtsdestoweniger ist es möglich, daß die Arbeiter radikale Organisationen bilden werden, um für Veränderungen in der Qualität ihres Lebens und ihrer Arbeit – und schließlich für Arbeiterselbstverwaltung über die Produktion – zu kämpfen“ (Bookchin 1970: 27).
Lehnt der autoritäre Ökosozialismus Gewerkschaften oftmals ab, setzt der libertäre Ökosozialismus auf Betriebsorganisationen. Ein Problem der Betriebsorganisationen benannte bereits der Anarchist Errico Malatesta (1853-1932). Entweder „bleiben sie dem Programm treu, bis sie schwach und machtlos sind“ oder aber, wenn „es ihnen gelingt, die Massen zu mobilisieren und die nötige Stärke zu erringen, um Verbesserungen zu fordern und durchzusetzen, wird das ursprüngliche Programm zu einer leeren Formel“ (Malatesta 1925/1980). Auch der historische Anarcho-Syndikalismus zielte ja nicht auf kleine, aber feine antikapitalistische Betriebsorganisationen ab, sondern hatte Massenorganisationen im Sinn. Dazu Torsten Bewernitz: „Die Grundidee des (revolutionären oder Anarcho-)Syndikalismus ist es gerade nicht, sich als Anarchist:in oder Anarchosyndikalist:in zu organisieren, sondern als Arbeiter:in“ (Bewernitz 2019: 13).
Insofern würden auch Bookchins radikale Betriebsorganisationen ebenso in die Irre gehen wie heute z.B. die Umweltgewerkschaft (https://umweltgewerkschaft.org/), die Arbeiter*innen auf ökologischer Grundlage organisieren möchte. Anders verhält es sich, wenn (anarcho)syndikalistische Ideen wiederaufleben, wenn es um die Beteiligung von Belegschaften an industriellen Konversionsprozesses geht. So schreiben Lukas Ferrari und Julia Kaiser im ak über die Belegschaft des italienischen Autozulieferers GKN in der Toskana. Unter der Überschrift ‚Ein ökosozialistisches Labor‘ wird berichtet, wie diese selbst Konversionspläne erarbeiten, ein Bündnis mit FFF schließen und mit der Gründung einer Genossenschaft ihre Betriebsbesetzung in eine Selbstverwaltung überführen wollen.[9] Nicht zu übersehen ist hierbei allerdings, dass es nicht die Utopie der Selbstverwaltung ist, die zur Betriebsbesetzung führt, sondern auf Kündigungen eine Betriebsbesetzung folgte, die sich in der Praxis die utopische Idee der Selbstverwaltung aneignet. Zugleich besteht die Gefahr, dass genossenschaftliche Ansätze, die eben nicht aus Massenstreiks hervorgehen, Nischen bleiben.
Für Ökosozialist*innen bleibt es daher unabdingbar, so sehr die politische Neutralität der großen Einheitsgewerkschaften im deutschsprachigen Raum oft nur ein versteckter Sozialdemokratismus ist, auch hier nach Bündnispartner*innen bzw. Interventionsmöglichkeiten zu suchen.
Zwar sind Gewerkschaften mit ihrer herkömmlichen Politik, so der Ökosozialist Wolfgang Fritz Haug, „in den Zirkel von einem quantitativ in Warenkonsum gemessenen Way of Life und auf einen auf entsprechende Ziele reduzierten Lohnkampf eingesperrt“ (Haug 1981: 19), nichtsdestotrotz sind sie als Verbündete wichtig, wofür sich aus organisations- und gewerkschaftstheoretischer Sicht vier Argumente anbringen lassen.
Erstens sind sie die Organisationen, die immer noch einen relevanten Teil der Belegschaften umfassen und mobilisieren. Zweitens findet sich bei diesen Belegschaften nicht nur das Interesse an einem ökologischen Umbau mit sozialer Ausrichtung, etwa in der Automobil- oder Energiebranche, sondern drittens auch das Wissen, wie eine Konversion bestimmter Produktionsanlagen zu gestalten wäre. Viertens verfügen Gewerkschaften über Machtressourcen, die für eine ökosozialistische Transformation notwendig sind.
Allerdings wissen wir aus Erfahrungen mit Kooperationen und Konflikten, wie belastet der Umgang von Umweltbewegten mit Gewerkschafter:innen oftmals ist. Jana Flemming hat sich damit in einer Studie über industrielle Naturverhältnisse befasst. Einige Ergebnisse helfen durchaus, Vorurteile abzubauen. „Im Resultat sind Gewerkschaftsmitglieder etwas umweltbewusster als jene, die keiner gewerkschaftlichen Organisation angehören (Bachon/Brecher 2016) […] Generell betrachten die Gewerkschafter:innen eine intakte Umwelt als etwas, das zu Lebensqualität, Wohlstand und Gesundheit der Beschäftigten beiträgt“ (Flemming 2022: 29). Dabei ist freilich eine gewisse Differenzierung vorzunehmen. Industriegewerkschaften positionieren sich hier durchaus anders als Dienstleistungsgewerkschaften. Flemmings Beispiel: „In einer Kampagne der IGBCE wurde auf einem Großbanner die Botschaft vermittel, dass ‘WIR’ (die Kohlearbeiter:innen) die ‘Schnauze voll von verfehlter Energiepolitik und Gewalt’ (der Ökoaktivist:innen) haben“ (ebd.: 13). Verfehlte Energiepolitik wäre hier der Kohleausstieg, Gewalt die gewaltfreien Besetzungs- und Blockadeaktionen von Ende Gelände. Fatal ist in diesem Zusammenhang die Einschätzung von Gewerkschafter:innen, „dass zu viele umweltpolitische Maßnahmen der Gewerkschaft die eigene Klientel dazu antreiben könnten, sich rechten politischen Gesinnungen anzuschließen und im entsprechenden Parteienspektrum zu wählen“ (ebd.: 187).
Diese Angst führt zur Lähmung und befördert Illusionen. Während manche Arbeiter:innen, z.B. im Kohlebereich, der Illusion verfallen, durch die Wahl der AfD ließe sich der Kohleausstieg aufhalten, wird die tatsächliche Debatte um dessen soziale Ausgestaltung blockiert. Gerade Gewerkschaften müssten sozialen Schieflagen ökoliberaler Umweltpolitik eine ökosozialistische Alternative entgegensetzen. Sofern dies von den bürokratischen Apparaten nicht erwartet werden kann, ist es Aufgabe einer ökosozialistischen Gewerkschaftsopposition sich dafür innerhalb der Einheitsgewerkschaften stark zu machen.
Innerhalb der IG Metall, immerhin die größte Gewerkschaft der Welt, gibt es hingegen eine lange Diskussion an die anzuknüpfen ist. Bereits 1972 führte sie eine Konferenz durch, deren Ergebnisse in Sammelbänden zu Themen wie Umwelt und Lebensqualität dokumentiert sind. „Vorschläge der IG Metall für ein humanes, umweltverträgliches und effizientes Verkehrssystem werden in ‘Auto, Umwelt und Verkehr’ (Neumann 1990) dargelegt“ (ebd.: 32). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die 2016 gestartete Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung, die mit einer Drosselung industrieller Produktion verbunden werden kann (vgl. ebd.: 33f.). Nicht zu unterschätzen ist die von den Gewerkschaften geleistete Bildungsarbeit als Multiplikator für sozial-ökologische Themen. Im Interview verweist ein Gewerkschafter die Forscherin beispielsweise auf einen „kürzlich erschienen Zeichentrickfilm der IG Metall über den nachhaltigen und klimafreundlichen Umbau der Industrie“ (ebd.: 154).
Über die Erfolge einer solchen Bildungsarbeit kann gestritten werden, allemal ist der Versuch besser als gar aus Angst vor rechtspopulistischen Stimmungen die Debatte mit den Belegschaften zu meiden. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass Faschismus mehr ist als eine Stimmung, sondern eine Antwort auf objektive Krisen.
Ist der Faschismus, historisch wie aktuell, nicht nur ein Extremismus der Mitte, sondern auch, wie der Philosoph Ernst Bloch (1885-1977) 1935 gezeigt hatte, ein Resultat von ‘Ungleichzeitigkeit’, so ist diese Analyse zu aktualisieren. Neben gleichzeitigen Konflikten auf der Höhe der Zeit, damals zwischen Kapitalismus und Sozialismus, stehen die Probleme mit denen Bevölkerungsgruppen zu tun haben, deren Situation von traditionellen, ungleichzeitigen Lebensformen geprägt ist. Mobilisierten die Nazis damals zum Beispiel Bauern und Handlungsgehilfen (Angestellte), so bemüht sich die AfD heute um Arbeiter:innen in der fossilen Energie- und Autobranche.
Deren Lage entspricht Blochs Begriff der Ungleichzeitigkeit, da sie vom vergangenen Fordismus geprägt ist und sich nicht auf der Höhe der Zeit – dem Konflikt zwischen sozialem oder technokratischem Umbau der Industrie – bewegt. Wie Bloch den Rückgriff auf spezifische Utopien dieser Milieus empfahl, etwa die Erinnerung an bäuerliches Gemeineigentum, so wäre auch heute an spezifische gewerkschaftliche Utopien wie die Wirtschaftsdemokratie zu erinnern.
Klaus Dörre formuliert drei Vorschläge an die Gewerkschaften. „Erstens sollten sich die Gewerkschaften in ihren Organisationsbereichen an einer neuen Aufklärung beteiligen, die […] die Notwendigkeit einer Nachhaltigkeitsrevolution offensiv begründet“, „zweitens, dass Gewerkschaften Politiken, die dem Klimawandel in erster Linie oder gar ausschließlich mit marktkonformen Mitteln (CO2-Bepreisung, Emissionshandel) zu Leibe rücken wollen, äußerst kritisch begegnen sollten“, „in diesem Zusammenhang sollten die Gewerkschaften drittens aber auch deutlich machen, dass es angesichts der dringend erforderlichen Nachhaltigkeitsrevolution keine bloße Rückkehr zu klassischer wohlfahrtsstaatlicher Umverteilungspolitik geben kann. Im Grunde geht es um die Rückverteilung gesellschaftlichen Reichtums und vor allem um eine Neuvertei-lung von Entscheidungsmacht in Wirtschaft, Betrieben und Unternehmen“ (Dörre 2019: 44f.).
Erstens Bildungsarbeit, zweitens eine Absage an den Ökoliberalismus, der sowohl die Lasten von Umweltpolitik an Konsumierende abwälzt als auch die Zukunft ganzer Industrien der Marktlogik ausliefert. Drittens Wirtschaftsräte und andere Formen der Wirtschaftsdemokratie, welche die anstehende Konversion unserer Produktions- und Lebensformen zum Gegenstand von Debatten macht, sie also weder den kapitalistischen Marktgesetzen noch einer technokratischen Regulationspolitik überlässt. Ökosozialismus wäre auch eine Utopie für Gewerkschaften.
Technokratische Lösungen, wie die Umstellung auf E-Mobilität, sind bei genauem Hinsehen weder ökologisch noch sozial. Woher soll der Strom kommen? Woher die nötigen Rohstoffe wie Lithium? (vgl. Flemming 2022: 136). Was bedeutet es für die Branche, dass E-Motoren wesentlich weniger Teile haben, ihre Montage mit einem Bruchteil der Beschäftigten auskommt? (vgl. ebd.: 167). Wird die Trennung von sozialen und ökologischen Fragen aufrechterhalten, erscheint die Ökologie Gewerkschafter:innen als etwas Äußerliches, „was von außen als diffuses anderes an die Organisation herangetragen wird“ (ebd.: 144). Flemming plädiert dafür, die Doppelrolle von Gewerkschaften wieder ernst zu nehmen, nämlich einerseits die ‘Klassenlage der Menschen’ im Kapitalismus anzuheben und andererseits eine ‘Aufhebung der Klassenlage’ selbst anzustreben (vgl. ebd.: 172).
Reduziert sich die gewerkschaftliche Debatte nur darauf, mit welcher Produktpalette einzelne Standorte konkurrenzfähig bleiben, bleibt diese eindimensional, die Arbeiter:innen selbst werden auf die Rolle als Lohnempfangende und Konsumierende beschränkt, die aber von tatsächlichen Entscheidungen ausgeschlossen bleiben. Sollen Utopien konkret werden, brauchen sie sowohl Träger:innen als auch eine mit ihnen verbundene Praxis.[10]
Was das utopische Bewusstsein bei Gewerkschafter:innen angeht, ist Flemming vorsichtig optimistisch: „Nicht zuletzt definieren sie häufiger die Idee einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer Zusammenführung ökologischer, ökonomischer und sozialer Themen und nähern sich damit ebenfalls umweltpolitischen Diskursen an“ (ebd.: 258). Zugleich sollte klar sein, dass es nicht auf Diskurse, sondern auf Praxen ankommt.
Als Testballon für die Zusammenarbeit zwischen ökologisch orientierten und gewerkschaftlichen Akteuren gelten die gemeinsamen Streiks von FFF und ver.di. Steffen Liebig und Kim Lucht haben Forschungen über diese Zusammenarbeit in einem Sammelband publiziert. Im Mittelpunkt stehen gegenseitige Lernprozesse. So berichten Florian Bremer, Lennart Markovic und Alina Schnier über Debatten zur Kooperation in Hamburg. „Aus Sicht der Beschäftigten kann ein ÖPNV nicht komplett kostenlos sein, da unter anderem Löhne gezahlt werden müssen – eine (vorläufige) Kompromisslinie stellte in diesem Zusammenhang die Forderung nach einem ‘ticketlosen ÖPNV’ […] dar“ (2022: 35). Vermutlich meinten die Aktiven von FFF mit ihrer kleinen Utopie des kostenlosen ÖPNV tatsächlich einen ticketlosen ÖPNV, den Gewerkschafter:innen kam jedoch die Aufgabe zu, diese Idee politisch zu erden. Ver.di forderte daher, wie Liebig und Lucht schreiben, nicht nur höhere Löhne, sondern klimapolitisch nötige Investitionen in Bus und Bahn (vgl. ebd.: 64). In diesem Sinne wäre ein ökosozialistischer Umbau, der unter kapitalistischen Bedingungen beginnt, auch Infrastruktursozialismus.
Verspricht sich die Gewerkschaft von der Kooperation einen Ausbau ihrer diskursiven, gesellschaftlichen Macht, indem eigene Interessen und Gemeinwohl als zusammengehörig dargestellt werden können, so hofft FFF auf „Streikmacht fürs Klima“ (Liebig/Lucht 2022: 64), wie das Jacobin Magazin schrieb. Sofern gemeinsame Aktionen als politische Streiks juristisch bekämpft werden können, geht das Vorhaben über das hinaus, worauf Gewerkschaften im deutschsprachigen Raum traditionell bauen, verrechtlichte institutionelle Macht. Der Organisationsmacht, also der Aktivierung der Menschen in Gewerkschaft und Bewegung kommt eine größere Bedeutung zu. Bei der Untersuchung der Zusammenarbeit in verschiedenen Städten zeigen sich spezifische Problemlagen.
In Bremen wurde die Kooperation eingestellt, weil ver.di hier auch Angestellte im Energie- bzw. Kohlebereich organisiert (vgl. Bremer/Markovic/Schnier 2022: 36). In Hamburg funktionierte die Zusammenarbeit, weil aktive Vertrauensleute der Gewerkschaften sich einbrachten (ebd.: 33). In Leipzig zeigte die Klimaskepsis von Gewerkschafter:innen, dass auf höherer Ebene beschlossene Bündnisse nicht automatisch von den Belegschaften umgesetzt werden (Liebig/Lucht 2022: 85). Bündnisse setzen eine Politik der Bedürfnisinterpretation, das heißt, soziale und politische Interessen entspringen nicht naturwüchsig aus einer bestimmten Lebenslage, sondern sind eine Interpretationsleistung. Um dazu zu ermutigen ist es wichtig, das Wissen der Beteiligten anzuerkennen, wie es FFF in Münster tat. Einerseits waren Aktive über die vertrauliche Nähe zwischen Gewerkschafter*innen und der Kapitalseite überrascht, wie Nam Duy Ngyuen und Julia Kaiser herausarbeiten (vgl. ebd.: 53). Andererseits: „Die Beschäftigten haben uns erzählt, wie absurd das alles ist: dass man den ÖPNV eigentlich zurückbaut und nur ein paar Pilotprojekte macht. Das sei nur Show. Das wussten die Beschäftigten“ (ebd.: 55). Persönliche Kontakte, über formale Bündnisse hinaus, sind entscheidend, um dieses Wissen teilen zu können. Gruppen der Gewerkschaftsopposition wie ‘Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für den Klimaschutz’[11] stiften Verbindungen. Klimapolitik, die ansonsten in den Diskursen der bürgerlichen Öffentlichkeit verhandelt wird, findet Eingang in die betriebliche Öffentlichkeit und die Alltagswelt der Menschen. In ähnlicher Weise bieten sich Bündnisse mit Ansätzen aus lokalen Öffentlichkeiten an.
4. Genossenschaften und Basisorganisationen
In der herrschenden ökologischen und sozialen Zangenkrise lässt sich die Perspektive des Ökosozialismus nicht auf die betriebliche Öffentlichkeit, in der Gewerkschaften wirken, oder die bürgerliche Öffentlichkeit, in der Parteien wie Bewegungen agieren, reduzieren. Immer wichtiger werden lokale und alltägliche Öffentlichkeiten, wo Genossenschaften und Basisorganisationen ansetzen. Gegenüber Genossenschaften sind viele Ökosozialismen optimistisch eingestellt, was eine Schnittmenge mit anderen sozialökologischen Ideen ausmacht. Freund:innen des Postwachstums sehen in dieser wirtschaftlichen Organisationsform sogar einen Ausweg. Niko Paech: „Regionalökonomien mit kleineren Unternehmen, die per se transparenter und demokratischer zu kontrollieren sind, erst recht dann, wenn es keine Aktiengesellschaften – die in einer Postwachstumsökonomie ohnehin deplatziert wären –, sondern Genossenschaften sind“ (Paech 2012: 118).
Kritischer verweist Cornelia Johnsdorf auf genossenschaftliche Insellösungen in der kapitalistischen Marktkonkurrenz. Bereits in den 1970ern und 1980ern versuchten sich Menschen am ‘Ausstieg aus dem Kapitalismus’ im Kleinen, in Landkommunen, ökologischen Produktions- und Konsumgenossenschaften. Bei alternativen Betrieben und Genossenschaften zeigen sich ähnliche Probleme wie bei der alternativen Partei. „Um als Betriebe langfristig zu überleben, mußten einige der oben genannten Prinzipien aufgegeben oder verändert werden. Das Rotationsprinzip wurde weitgehend aufgegeben. […] Die Erfahrung, daß die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter/innen auch in diesen Arbeitszusammenhängen recht unterschiedlich ausfällt, hat die Betriebe dazu bewogen, vom Modell der Einheitslöhne Abstand zu nehmen“ (Johnsdorf 1998: 152). Wie sich die Grünen der Parteienkonkurrenz anpassten, so die Betriebe dem Markt.
Was bleibt also von dieser ökonomischen Organisationsform – jenseits von Paechs Idealismus und Johnsdorfs Kritik – zu erwarten? Für die Autorin bieten alternative Genossenschaften eine „Möglichkeit, Voraussetzungen einer nicht-entfremdeten Gesellschaft überhaupt zu erproben“ (ebd: 164.). Die Beweiskraft solcher Experimente sollte aber auch nicht überschätzt werden. Die Unfähigkeit einer Wohngemeinschaft, den eigenen Abwasch nachhaltig und geschlechtergerecht zu organisieren, widerlegt nicht die Möglichkeit einer überregionalen Kanalisation. In der Tat gibt es viele Beispiele, wo Alternativen an einem zu kleinen Versuchsmaßstab scheitern müssen. So ist „eine Wirtschaftsordnung mit selbstverwalteten Betrieben ohne hierarchische Strukturen“ (Die Grünen, Sindelfinger Programm, zit. n. Ebermann/Trampert 1984: 274) anders einzuschätzen, je nachdem ob wir über lediglich einen Betrieb, bloß ein Land, nur einen Kontinent oder über eine ökosozialistische Weltrepublik nachdenken.
Sollen sich genossenschaftliche Organisationsformen aber gerade dadurch auszeichnen, dass sie alltagstauglich sind, wie etwa heutige Solidarische Landwirtschaften, ist der Zeithorizont anders gesetzt. Was bringen Energiegenossenschaften heute? Flemming erwähnt den Bericht einer IGM-Gewerkschafterin: „So haben ‘die Emdener’ ihre eigene Stromgenossenschaft in einem Automobilwerk gegründet. Doch sind dies ‘Inseln’, auf denen engagierte Leute ‘rumfrickeln’“ (Flemming 2022: 155). Nichts gegen Bürger:innen-Energiegenossenschaften, aber solange diese nur als Nische, neben der herkömmlichen hochzentralisierten fossilen oder nuklearen Energieproduktion bestehen, ist dies ein Problem. Gerade aus ökosozialistischer Perspektive kann es fragwürdig sein, sich mit der Gründung genossenschaftlicher Betriebe zu begnügen, wenn andere große Betriebe reif zur Vergesellschaftung sind.
Eher politisch als ökonomisch ist die Bedeutung, die der gesellschaftskritische Politikwissenschaftler Joachim Hirsch genossenschaftlichen Ansätzen der Selbst-Organisation zumisst. Die Kommunen und die Alternativökonomie der 1970er und 1980er nennt er treffend eine „sozialrevolutionäre ‚Infrastruktur‘“ (Hirsch 1980: 136), sofern es hier nicht um den Rückzug aus dem politischen Alltag geht, sondern die Verbindung zu anderen Organisationsformen gehalten wird. Gerade Aktive in sozialen Bewegungen brauchen günstigen Wohnraum, leckeres Essen, Bildungs- und Begegnungsorte. Sofern genossenschaftliche Ansätze wie das Mietshäusersyndikat, Solidarische Landwirtschaften oder der Zusammenschluss autonomer Zentren (zazonline.noblogs.org) dazu beitragen, erfüllen sie wichtige Zwecke. Zentral ist dabei auch immer die Idee, dass diese genossenschaftlichen Organisationsformen näher am Alltag der Menschen sind.
Ähnliches gilt für die Ansätze von Basisorganisationen, die seit einigen Jahren im deutschsprachigen Raum immer beliebter werden. Einen Ursprung haben diese im so genannten Community-Organizing, wie es Saul D. Alinksy entwickelt hat. „Nirgendwo werden die Zwänge, Spannungen und Konflikte der modernen Industriegesellschaft auf so dramatische Weise deutlich wie im eigentlichen Herzen dieser Zivilisation, den Stadtteilen“ (Alinsky 1946: 41). Anders als Betriebs- oder Bewegungsorganisationen, die sich auf einige Betriebe bzw. einige ausgewählte Themen konzentrieren können, betont er den umfassenden Anspruch seines Organisationsansatzes. „Eine Basisorganisation wird unweigerlich feststellen, dass ihre Probleme alle Aspekte des Lebens berühren. Aus diesem Grund unterscheidet sich ein Organizing-Programm von den herkömmlichen Programmen einer durchschnittlichen Gruppe, die sich in einer Bürgerinitiative oder einem Stadtteilverein zusammenschließt“ (Alinsky 1946: 75). Bürgerinitiativen sind häufig mit Veränderungen in spezifischen Politikbereichen zufrieden zu stellen. In den städtischen Vierteln der Armen sind die Probleme so grundlegend, dass eine erfolgreiche Politisierung nur umfassend gedacht werden kann.
Kennen wir im Ökosozialismus solche Basisorganisationen? Armin Kuhn schrieb 2023 in seinem Artikel ‘Nachbarschaften für Klimagerechtigkeit: „Schon länger haben Mieten- und Klimabewegung versucht, sich stärker aufeinander zu beziehen“.[12] Für Basisorganisationen sind Mietfragen, neben Problemen mit dem Jobcenter und Ausländerbehörden, das wichtigste Themenfeld für die Stadtteilorganisierung. Auch wenn im Fall der anstehenden Heizungsmodernisierungen nur 8% der Sanierungskosten auf Mietende umgelegt werden können, so soll diese Mieterhöhung doch auf Dauer gelten. Entsprechend stehen hier soziale gegen ökologische Fragen. Kuhn sieht Potential für gemeinsame Forderungen in diesem Bereich: „Dazu muss die Wärmewende von der Ebene des einzelnen Hauses auf die Quartiersebene gehoben werden, als öffentliche Infrastruktur“.
Zu ergänzen wären weiterhin auch Forderungen nach ÖPNV-Ausbau, Sanierungen statt Neubau, Grünflächen u.ä. In der Kooperation mit Basisorganisationen entsteht ein neues Aktionsfeld. „Mit solchen Forderungen können Nachbar:innen gemeinsam agieren und Druck für eine klimagerechte Umsetzung aufbauen“.
Für die Basiskampagne der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen, die mit ihren Kiezteams Methoden von Basisorganisationen mit Aspekten von Bewegungsorganisationen (z.B. Demos) kombiniert, interpretiert Lisa Vollmer Vergesellschaftung ökosozialistisch. „Anders als Immobilienkonzerne müsste mit öffentlichen Wohnraum keine Rendite erzielt werden – das Geld stehe also für Modernisierungen zur Verfügung, ohne dass Mieter:innen blechen müssten. Dann würden sich Mieter:innen auch für energetische Sanierungen entscheiden. ‚Die Vergesellschaftung ist die Antwort auf die soziale und ökologische Frage.‘“[13]
Ein anderer Fall von Basisorganisation in eher ländlichen Communities ist die Kampagne ‘Alle Dörfer bleiben’ (https://www.alle-doerfer-bleiben.de/), wobei es sich hier interessanterweise um mehrere lokale Öffentlichkeiten handelt, die überregional vernetzt sind, nämlich um Dörfer im Rheinland, im Leipziger Raum und der Lausitz, die dem Kohletagebau zum Opfer fallen soll(t)en.
Ein drittes Beispiel wären selbstgeschaffene lokale Ansätze. Bei der Besetzung im Hambacher Forst (Hambi) 2012 bis 2018 sowie bei der Besetzung im Danneröder Forst (Danni) 2019 bis 2020 und bei anderen Aktionen kam es sowohl zur Bildung von temporären aktivistischen Communities als auch zur Organisierung eines sympathisierenden Umfelds.
Ähnlich wie bei Gewerkschaften und Betriebsorganisationen bietet die Zusammenarbeit mit Genossenschaften und Basisorganisationen große Chancen, um die Klimagerechtigkeitsbewegung, über Parteikontakte hinaus, breiter aufzustellen und Menschen über Demos hinaus zu erreichen. Gerade wo Belegschaften und Nachbarschaften ökologische Politik im ökoliberalen Sinne eher als Zumutung erleben, zum Beispiel durch wegfallende Jobs und abgewälzte Kosten, sind ökosozialistische Perspektiven notwendig.
Kurzfristig: „Klimaschutz ist bezahlbar, es ist nur eine Frage der Verteilung“ (Kuhn 2023). Mittelfristig: „Die Rekommunalisierung oder Vergesellschaftung von Wohnungen und der Wärmeversorgung sind weitere wichtige Forderungen“ (ebd.). Langfristig gilt die Vergesellschaftungsperspektive auch für Schlüsselindustrien sowie die Energie- und Verkehrswende. Infrastruktur gehört in öffentliche Hände, was nicht bloße Verstaatlichung meinen muss, sondern unter Einbezug von Gewerkschaften und Genossenschaften den Aufbau einer (öko-)sozialen Republik im Wortsinn der res publica, der öffentlichen Sache.
5. Ökosozialismus und verbindende Organisierung
Klimakrise und Sozialabbau, Umweltzerstörung und Klimagerechtigkeit sind Querschnittsthemen mit denen sich unterschiedliche Organisationsformen beschäftigen (können). Für Gewerkschaften und Betriebsorganisationen in der Arbeitswelt sind Prozesse sozial-ökologischer Transformation ebenso wichtig wie für Parteien und Bewegungsorganisationen, die in der bürgerlichen Öffentlichkeit agieren. Auch genossenschaftliche Organisationsformen und Basisinitiativen, von Energiegenossenschaften bis hin zu Stadtteilgruppen, sind mit Problemen befasst, die soziale und ökologische Aspekte haben. Der Ökosozialismus als politische Strömung beansprucht, passende Kritiken und Utopien zu verbinden.
Zu unverbunden und unkoordiniert ist allerdings bis heute das Engagement von Ökosozialist:innen im weitesten Sinne in den verschiedenen Organisationsformen. Ob ‘Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für den Klimaschutz’ im DGB oder die Unterstützer:innen der besetzten Öko-Seifen-Fabrik vio.me in der Nähe von Thessaloniki in der anarchosyndikalistischen Betriebsorganisation Freie Arbeiter:innen Union, ob die Ökologische Plattform in der PDL oder Ökosozialist:innen in Bewegungsorganisationen wie Ums Ganze, Interventionistische Linke, Ende Gelände, attac oder Fridays for Future, ob Energiegenossenschaften oder Basisprojekte wie ‘Alle Dörfer bleiben’ – überall gilt, dass zwar ökologische und soziale Fragen zusammen gedacht werden, eine verbindliche Orientierung an ökosozialistischer Kritik und Utopie aber ebenso fehlt wie gemeinsame Organisierung. Kann der Ökosozialismus hierfür eine inhaltliche Klammer bieten? Wie der Sozialismus der Alten Linken an den drei Säulen Gewerkschaft, Partei, Genossenschaft orientiert war, kann auch der Ökosozialismus auf keine dieser Organisationsformen verzichten. Wichtig wird ein organisationstheoretisch fundiertes Verständnis der Unterschiede, das hiermit zur Diskussion gestellt wird.
Hinzu kommen, angestoßen durch die Zwischenkriegslinke und die Neue Linke, die Ansätze der Betriebs-, Bewegungs- und Basisorganisationen. Die Vorstellung einer Einheitsorganisation, die alles abdecken kann, scheint heute nicht auf der Tagesordnung zu stehen. Zu warnen ist allerdings vor der Zersplitterung in Kleinstgewerkschaften und Kleinstparteien, Einpunkt-Bewegungen und genossenschaftliche Nischenansätze, schlimmstenfalls: Freundeskreise und Szenen als Pseudoorganisierung. Zu lernen wäre vielmehr, wie sich unterschiedliche Organisationsformen gegenseitig ergänzen können, ohne dabei Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze auszublenden (Vgl. Neupert-Doppler 2021). Ein entscheidendes Element werden dabei Aktionsformen sein, die über bekannte Kontexte hinaus angewendet werden. Fridays for Future haben dies mit dem Klimastreik ebenso vorgelebt wie vor Ihnen der Refugeestrike, mit dem Geflüchtete ihre Lagerunterbringung bestreikten (vgl. Doppler 2022), Frauenstreiks oder Mietenstreiks im europäischen Süden. Weitere Pfeile im Köcher von Bewegungs- und Basisorganisationen, etwa Besetzungen, Boykotte und Blockaden, sind ebenfalls vielfältiger einsetzbar. Besetzungen, nicht nur von Wäldern, sondern von Fabriken durch die eigenen Belegschaften, die diese wie in Argentinien übernehmen (vgl. Azzelini 2018); Boykotte, verbreitet mittels der medialen Aufmerksamkeit, die Parteien genießen; Blockaden, die nicht nur auf Tagebaue und Straßen abzielen, sondern auch Parteitage und die Alltagsbürokratie einbeziehen. All dies würde das Kampffeld der Klimagerechtigkeitsbewegung über die Sphäre der bürgerlichen Öffentlichkeit, also Straße und Parlament, hinaus erweitern ins Betriebliche und ins Lokale. Damit dies möglich wird, braucht es Aufklärung und Gelegenheiten, gegenseitiges Verständnis für verschiedene Organisationsansätze und eine geteilte Utopie, Ökosozialismus als herrschaftskritisches und emanzipatorisches Projekt, auf das sich verschiedene Organisationen beziehen können.
Literatur & Referenzen
Bildquelle: Foto von Jason Leung auf Unsplash
Alinsky, Saul D. (1946/2010): Reveille for Radicals, übersetzten Auszüge, in: Call me a Radical, Berlin.
Azzellini, Dario (2018): Vom Protest zum sozialen Prozess – Betriebsbesetzungen und Arbeiten in Selbstverwaltung, Hamburg.
Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit (1996): Grenzen der Globalisierung, Münster.
Bewernitz, Torsten (2019): Syndikalismus und neue Klassenpolitik – Eine Streitschrift, Berlin.
Bookchin, Murray (1970): Vorwort in Formen der Freiheit, Asslar-Werdorf.
Bookchin, Murray (1992): Die Umweltkrise und die Notwendigkeit gesellschaftlicher Erneuerung, in: Die nächste Revolution (2006), Münster.
Bremer, Florian/Markovic Lannart/Schnier, Alina (2022): Hamburg, in: Steffen Liebig/Kim Lucht (Hg.): Fahren wir zusammen? Die öko-soziale Allianz von ver.di und Fridays for Future im ÖPNV, Hamburg, S. 32-41.
CampusGrün (2019): Wege zum Ökosozialismus, online: https://www.campusgruen.org/va%C3%B6ksozII/ (eingesehen am 18.7.23).
Ditfurth, Jutta (1987): Lafontaine ein Linker? Käse, alles Käse! in (1988): Träumen-Kämpfen-Verwirklichen, Köln, S. 276-286.
Ditfurth, Jutta (2011): Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: Die Grünen, Berlin
Doppler, Lisa (2022): Widerständiges Wissen – Herbert Marcuses Protesttheorie in Diskussion mit Intellektuellen der Refugee-Bewegung der 2010er Jahre, Bielefeld.
Dörre, Klaus (2019): Die Gewerkschaften – progressive Akteure einer Nachhaltigkeitsrevolution? In: spw 4, S. 38-46.
Ebermann, Thomas/Trampert, Rainer (1984): Die Zukunft der Grünen. Ein realistisches Konzept für eine radikale Partei, Hamburg.
Engert, Klaus (2010): Ökosozialismus – das geht! ISP Verlag, Köln.
Flemming, Jana (2022): Industrielle Naturverhältnisse – Politisch-kulturelle Orientierungen gewerkschaftlicher Akteure in sozial-ökologischen Transformationsprozessen, München.
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz, online: www.labournet.de/wpcontent/uploads/2017/04/gew_klimaschutz.pdf (eingesehen am 18.7.23)
Harich, Wolfgang (1975): Kommunismus ohne Wachstum – Babeuf und der ‚Club of Rome‘, Hamburg.
Haug, Wolfgang F. (1981): Einundzwanzig Thesen zu Ökologie und Sozialismus. In: Argument-Sonderband 56, Berlin
Hirsch, Joachim (1980): Alternativbewegung – eine politische Alternative? In: Roth, Roland (Hg.): Parlamentarisches Ritual und politische Alternativen, Frankfurt a.M., S. 121-146.
Johnsdorf, Cornelia (1998): Nachhaltigkeit – Entfremdung – selbstverwaltete Betriebe, Dissertation im Eigendruck.
Kern, Bruno (2019): Das Märchen vom grünen Wachstum – Plädoyer für eine nachhaltige Gesellschaft, Zürich.
Kühnert, Kevin (2019): Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert? Interview in Die Zeit, online: https://web.archive.org/web/20190501150554/ https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht (eingesehen am 18.7.23).
Kuhn, Armin (2023): Nachbarschaften für Klimagerechtigkeit, online: https://www.akweb.de/bewegung/waermewende-heizungsgesetz-nachbarschaften-fuer-klimagerechtigkeit/ (eingesehen am 18.7.23).
Kurz, Robert (2003): Die antideutsche Ideologie – Vom Antifaschismus zum Krisenimperialismus: Kritik des neuesten linksdeutschen Sektenwesens in seinen theoretischen Propheten, Münster.
Liebig, Steffen/Lucht, Kim (2022): Strategiedebatten – Ökologische Klassenpolitik zwischen Klimaaktivismus und Bewegungsgewerkschaft, in dies. (Hg.): Fahren wir zusammen? Hamburg, S. 61-65 [und: Fazit, S. 83-89).
Malatesta, Errico (1925/1980): Syndikalismus und Anarchismus, Berlin, online: https://www.anarchismus.at/anarchistische-klassiker/errico-malatesta/172-errico-malatesta-syndikalismusund-anarchismus oder (2014/1922): Syndikalismus und A., S. 150-161, Münster.
Ngyuen, Nam Duy/Kaiser, Julia (2022): Münster(-land), in: Liebig, Steffen/Lucht, Kim (Hg.): Fahren wir zusammen? Hamburg, S. 52-60.
Neubauer, Luisa (2022): Nur weil die Richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert, online: https://www.zeit.de/2022/24/gruene-klimapolitik-ernergie-oel-luisa-neubauer (eingesehen am 18.7.23).
Neupert-Doppler, Alexander (2022): Ökosozialismus – Eine Einführung, Wien.
Neupert-Doppler, Alexander (2021): Organisation – Von Avantgardepartei bis Organizing, Stuttgart.
Neupert-Doppler, Alexander (2019): Die Gelegenheit ergreifen – Eine politische Philosophie des Kairós, Wien.
Neupert-Doppler, Alexander (2015): Utopie – Vom Roman zur Denkfigur, Stuttgart.
Neupert, Alexander (2013): Staatsfetischismus – Zur Rekonstruktion eines umstrittenen Begriffs, Münster.
Ökologische Plattform in der PDS (2006): Ökosozialistisches Manifest, online:https://www.oekologische-plattform.de/2006/09/ oekosozialistisches-manifest/ (eingesehen am 18.7.23).
Paech, Niko (2012): Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, München.
Peters, Anna (2019): Autofreie Innenstädte und Sozialismus: Was Anna Peters von der Grünen Jugend für Deutschland plant, Interview im Spiegel, online: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anna-peters-gruene-jugend-ueber-radikalitaet-autofreie-innenstaedte-und-sozialismus-a-124cc433-2a07-483b-82ca-93f3fe782679 (eingesehen am 18.7.23).
Sarkar, Saral (2001): Die nachhaltige Gesellschaft – Eine kritische Analyse der Systemalternativen, Zürich.
Scherer, Klaus-Jürgen (2023): Ökosozialismus – Keine neue Debatte, aber von neuer Aktualität, in PerspektivenDS, Marburg, S. 35-46.
Vollmer, Lisa (2022): Enteignen ist besser für das Klima, taz-Interview, online: https://taz.de/Klimagerechtes-Enteignen-von-Wohnungen/!5874971/ (eingesehen am 18.7.23).
Zeller, Christian (2020): Revolution für das Klima – Warum wir eine ökosozialistische Alternative brauchen, München.
Zelik, Raul (2022): Was Sie schon immer über die Linkspartei wissen wollten, online: https://www.akweb.de/bewegung/was-sie-schon-immer-ueber-die-linkspartei-wissen-wollten/ (eingesehen am 18.7.23).
Referenzen
[1] Zur Kritik des Rechts-, Politik- und Staatsfetischismus vgl. Neupert (2013): Staatsfetischismus, LIT-Verlag.
[2] https://www.zeit.de/2022/24/gruene-klimapolitik-ernergie-oel-luisa-neubauer
[3] www.oekologische-plattform.de/2006/09/okosozialistisches-manifest/
[4] Vgl. Neupert-Doppler (2019): Die Gelegenheit ergreifen, Mandelbaum.
[5] Vgl. Zelik (2022): https://www.akweb.de/bewegung/was-sie-schon-immer-ueber-die-linkspartei-wissen-wollten/
[6] https://web.archive.org/web/20190501150554/https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/kevin-kuehnert-spd-jugendorganisation-sozialismus/komplettansicht
[7] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anna-peters-gruene-jugend-ueber-radikalitaet-autofreie-innenstaedte-und-sozialismus-a-124cc433-2a07-483b-82ca-93f3fe782679
[8] https://www.campusgruen.org/va%C3%B6ksozII/
[9] Ein ökosozialistisches Labor? –analyse & kritik 694, 20. Juni 2023 https://www.akweb.de/ausgaben/694/ein-oekosozialistisches-labor/
[10] Vgl. Neupert-Doppler (2015): Utopie, Schmetterlingsverlag.
[11]www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/04/gew_klimaschutz.pdf
[12] Armin Kuhn : Nachbarschaften für Klimagerechtigkeit. analyse&kritik 694, 20. Juni 2023 https://www.akweb.de/bewegung/waermewende-heizungsgesetz-nachbarschaften-fuer-klimagerechtigkeit/
[13] Enteignen ist besser für das Klima. Tageszeitung, 30.8.2022 https://taz.de/Klimagerechtes-Enteignen-von-Wohnungen/!5874971/