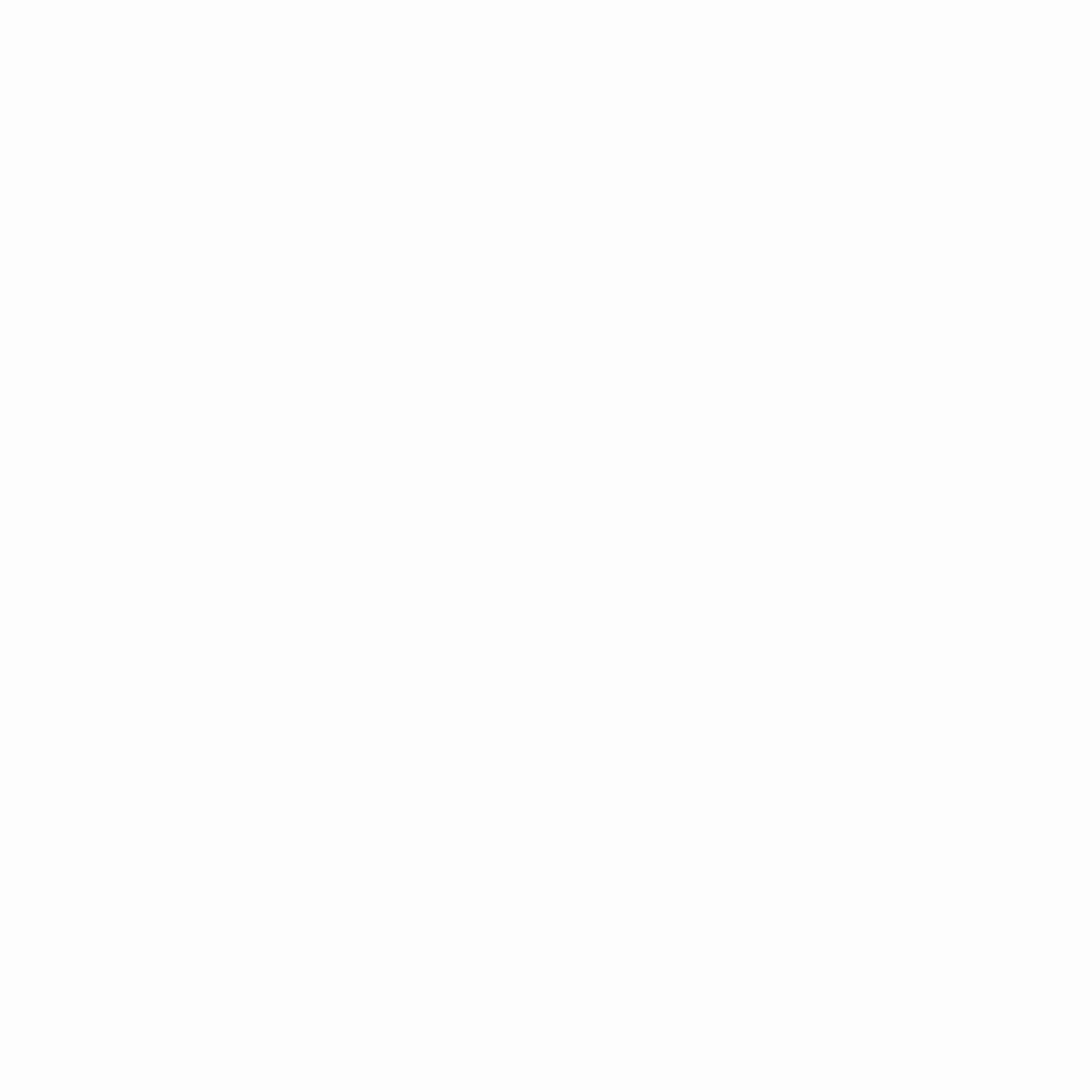Share This Article
Das Konzept von Revolution stellt heute für Marxist:innen eine der grössten Herausforderungen dar. Die praktische Umsetzung von Revolution wirft sogar noch grössere Schwierigkeiten auf.
Das sind knallharte Wirklichkeiten, die Marxist:innen anerkennen müssen. Mit einem Kapitalismus, der auf ökologische Katastrophen, Wellen der Pandemien und neuer Formen autoritärer Herrschaft zusteuert, erscheint die Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution offensichtlich. Und doch bleiben die Wege zu so einer Revolution weiterhin schwer zu fassen.
Letzten Endes, haben wir während der letzten vier Dekaden des Neoliberalismus einen enormen Rückgang von Massenkämpfen gesehen, die neue Formen von Machtausübung durch die Arbeiter:innenklasse und die Bevölkerung verkörpern würden. Und dies ist verantwortlich für einen anhaltenden Kollaps der historischen Vorstellungskraft und der revolutionären Perspektive innerhalb der revolutionären Linke.
Revolutionäre Kämpfe in der Geschichte
Dies wäre wohl auch zu erwarten gewesen. Denn durch die Geschichte der sozialistischen Bewegung hindurch hatte die Idee von Revolution stets konkrete historische Bezüge gehabt. Die tatsächliche Erfahrung aufständischer Massenkämpfe hat die Strategie von Revolutionär:innen stets massgebend beeinflusst und geformt. Marx und Engels konzipierten ihr Modell von Volksaufständen aus den Erfahrungen der Strassenkämpfe und Barrikaden von 1848 [Februarrevolution in Frankreich und Märzrevolution in den deutschen Fürstentümern, Anm. d. Red.]. Danach waren es die Ereignisse der Pariser Kommune 1871, die die beiden antrieben, die Formen des Klassenkampfes der Arbeiter:innen um die politische Vorherrschaft zu überdenken.[1]
Die Zentralität des Massenstreiks für Rosa Luxemburgs politische Vorstellungen leitete sich direkt von ihrer Teilnahme an den Streikwellen während der Russischen Revolution 1905 ab. Und es war die Schaffung der Sowjets [Arbeiter:innen- und Soldatenräte, Anm. d. Red.], die Lenin und die Bolschewiki dazu führten, den Kampf um den Sozialismus im russischen Zarenreich radikal neuzudenken [die etablierte marxistische Sozialdemokratie wollte zunächst einen bürgerlichen Staat, um übergangsweise unter einem parlamentarischen System den Kapitalismus zu entwickeln, Anm. d. Red.].
Antonio Gramsci verwob die Lehren aus der Russischen Revolution 1917 mit denjenigen aus der gescheiterten Revolution in Italien 1920 zu einer anhaltenden Reflektion über marxistische Strategien und Politik. Ähnlich waren es nach dem Zweiten Weltkrieg die antikolonialistischen Revolutionen – ihre Erfolge und Misserfolge –, die die Perspektiven von C.L.R. James, Frantz Fanon und Walter Rodney für die Weltrevolution in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts inspirierten.
Fehlende Orientierungspunkte für die Linke heute
Die sozialistische Linke leidet heute aufgrund der überwältigenden Absenz ähnlicher Erfahrungen. Nur um sicherzustellen, Massenaufstände sind nicht gänzlich verschwunden. Tatsächlich habe ich erst kürzlich über die jüngste Rückkehr des Massenstreiks als Form des Kampfes geschrieben.[2] Nichtsdestotrotz bleibt dieses Problem. Ein Problem, das von den Herausgeber:innen des hervorragenden neuen Bandes „Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Era„, das demnächst bei Haymarket Books erscheinen wird, identifiziert wurde.
Indem die Herausgeber:innen von „Revolutionary Rehearsals“ die Aufstände der letzten Jahre mit denjenigen der Periode zwischen 1968 und 1976 vergleichen – der Epoche allgemeiner Streiks, Student:innenrebellionen sowie der Fabrikbesetzungen in Frankreich und Pakistan (1968), der Bildung von Fabrikkomitees während der Zeit der sogenannten Unidad Popular (1970-73) [Wahlbündnis von linken chilenischen Parteien und Gruppierungen unter Salvador Allende, Anm. der Red.], und der embryonischen Rätebewegung in Portugal während des Umsturzes des Faschismus (1974- 75) –, stellen sie eine zentrale Frage.
Sie anerkennen, dass Proteste der Gesamtbevölkerung überall um uns herum gesehen werden können. Doch fragen sie sich auch, ob sie dabei „die militanten Arbeiter:innen und die Besetzungen der Arbeitsplätze, die Landbesetzungen und die fabrikübergreifenden Streikkomitees“ finden können?[3] Kurz, wo finden wir die embryonischen Formen von einer Arbeiter:innen- und Volksmacht, die möglicherweise eine Alternative zur Herrschaft des kapitalistischen Staates schaffen?
Das Problem ist dabei nicht bloss, dass die Arbeiter:innenklasse einfach eine Serie von Niederlagen unter dem Neoliberalismus erlebt hat. Es geht auch darum, dass die Massenaufstände der letzten Dekaden – von Südafrika bis Polen, von Südkorea bis Indonesien – sich mit ihren demokratischen Ambitionen allzu oft in liberale Marktregimes haben integrieren lassen. Mit der Ausnahme des pink tide-Moments in Lateinamerika [zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es in Lateinamerika einen allgemeinen Linksrutsch gegen den Neoliberalismus, Anm. d. Red.], haben diese Aufstände nur selten die Stärkung der Arbeiter:innenbewegung und der sozialistischen Linken zur Folge gehabt.
Der Niedergang der Idee einer sozialistischen Revolution geht daher auch Hand in Hand mit einem relativen Zusammenbruch von aufständischen, linksneigenden Volksaufständen.
Der neue Reformismus
Das ist der Kontext für den Aufstieg eines neuen und mutigeren sozialdemokratischen Reformismus, insbesondere in den USA. Angeregt durch teils episodische Erfolge der Präsidentschaftskampagnen von Bernie Sanders 2016 und 2020 hat eine Schicht an Intellektuellen und Aktivist:innen in und um die Democratic Socialists of America (DSA) das parlamentarische Erbe des deutschen sozialdemokratischen Theoretikers Karl Kautsky angetreten.[4] Heute verstärkt der neue Kautskyismus eine Fixierung auf die Wahlarena, die Teile der sozialistischen Linken ausser Gefecht zu setzen droht. Die Übernahme des Elektoralismus [hier: einseitige Fokussierung auf parlamentarische Wahlen; Anm. d. Red.] untermauert linke Praktiken, die die Mobilisierung zur Verteidigung der Leben von Schwarzen vernachlässigen, die sich der Forderungen, der Polizei die Finanzierung zu entziehen, entgegenstellen, und die keinen müden Finger für gewerkschaftliche Organisierungsaktivitäten bei Amazon rühren.[5] Dies hat durchaus politisches System, denn, wie Kautsky selbst halbwegs einräumte, war sein „passiver Radikalismus“ misstrauisch gegenüber sozialistischen Bemühungen, einen Aufstand der Arbeiter:innenklasse aufzubauen.[6]
«Das Problem ist dabei nicht bloss, dass die Arbeiter:innenklasse einfach eine Serie von Niederlagen unter den dem Neoliberalismus erlebt hat. Es geht auch darum, dass die Massenaufstände der letzten Dekaden – von Südafrika bis Polen, von Südkorea bis Indonesien – sich mit ihren demokratischen Ambitionen allzu oft in liberale Marktregimes haben integrieren lassen.»
All dies macht eine kritische Auseinandersetzung mit dem neuen Reformismus sehr wertvoll.[7] Dennoch stösst eine solche Zusammenarbeit auf reale Grenzen. Denn der wiedergeborene Kautskyismus behält trotz der Entlarvung seiner theoretischen Verwirrungen und historischen Ausweichmanöver Bestand. Und das liegt daran, dass es der linken Alternative an Glaubwürdigkeit zu mangeln scheint. Hier brauchen Marxist:innen erhebliche Ehrlichkeit und Selbstreflexion. Andernfalls läuft der Kampf für die Revolution Gefahr, weiter in die Defensive zu geraten.
Deshalb müssen wir eine historisch-materialistische Darstellung unserer Zwangslage entwickeln. Wir müssen die sozialgeschichtlichen Prozesse, die revolutionäre Bewegungen an den Rand gedrängt haben, rigoros und besser analysieren, um die eigentliche Bedeutung der sozialistischen Revolution heutzutage kritisch neu zu hinterfragen. Aber zuvor müssen wir die Schlüsselbegriffe der Diskussion klären.
Die Politik der Doppelherrschaft
Was ist also mit der sozialistischen Revolution? Um auf diese Frage einzugehen, brauchen wir zunächst eine Klarheit über die grundlegenden Begriffe der Debatte. Entscheidend ist dabei, dass man sich mit der Behauptung auseinandersetzt, revolutionäre Politik sei eine Art von Insurrektionismus [spontane «Aufständigkeit», Anm. d. Red.].[8]
Diese Behauptung ist nicht vollkommen neu. Sie wurde von Ralph Miliband [belgisch-britischer Marxist, Anm. d. Red.] in den 1970er Jahren propagiert. Statt Sozialist:innen in ein reformistisches und ein revolutionäres Lager einzuteilen, schlug Miliband daher vor, sie entweder dem „konstitutionalistischen“ [den bürgerlichen Staat anerkennend, Anm. d. Red.] oder dem „aufständischen“ Lager zuzuordnen. Obwohl Miliband einräumte, dass diese Kategorisierung nicht ohne „Probleme“ sei, fuhr er fort zu behaupten, dass die Mitglieder des letzteren Lagers etwas namens „aufständische Politik“ praktizierten.[9] Dazu muss aber gesagt sein, dass seine Beschreibung von diesen zwei politischen Lagern nur wenig Konkretes über die Ansichten der meisten revolutionären Sozialist:innen verriet.
Während Miliband sich mit der Idee des Aufstandes auseinandersetzte, ignorierte er aber die drei entscheidenden und miteinander verbundenen Forderungen, die für den revolutionären Ansatz grundlegend sind. Erstens ist da das Bestehen darauf, dass die entfremdenden und bürokratischen Formen des kapitalistischen Staates nicht für den Einsatz um sozialistische Ziele geeignet sind.[10] Zweitens ist damit die Idee verbunden, dass die sozialistische Transformation der Gesellschaft die Kultivierung neuer Institutionen der basisdemokratischen Arbeiter:innen- und Volksmacht erfordert. Verwurzelt in den Betrieben und Gemeinden, sollten diese Räte oder Versammlungen eine radikal direktere und stärker partizipatorische Form der demokratischen Willensbildung von unten verkörpern – eine, die die radikale Demokratisierung und die Überwindung der Entfremdung politischer Macht ermöglicht. Schliesslich argumentieren Sozialist:innen in der revolutionären Tradition, dass aufständische Arbeiter:innenbewegungen zumindest seit der Pariser Kommune von 1871 eine historische Neigung gezeigt haben, genau solche Institutionen der Arbeiter:innen- und Volksmacht zu schaffen.
Deshalb lässt sich die revolutionäre Perspektive am treffendsten als Doppelherrschaftsstrategie beschreiben, weil sie neue Zentren der Arbeiter:innen- und Volksmacht ausserhalb der (und in Opposition zu den) Apparaten des alten Staates fördert. In diesem Szenario schafft der Aufbau der Arbeiter:innenmacht neue Institutionen der demokratischen Selbstverwaltung, die die Macht des alten Staates in Frage stellen. Daher: Doppelherrschaft, eine Strategie des Aufbaus neuer Zentren der Volksmacht neben den alten – und mit dem Ziel, diese zu ersetzen.
Tatsächlich rechnen Revolutionär:innen damit, dass direkte Konflikte zwischen diesen konkurrierenden Machtzentren aufflammen werden – insbesondere zwischen der aufständischen Massenbewegung und den Institutionen der Unterdrückung wie der Armee, der Polizei und dem Gefängniskomplex. „Aufstände“ treten aber nicht automatisch auf, sondern wenn die revolutionäre Bewegung gezwungen ist, die sozialen Konflikte zwischen sich und den etablierten Zentren der alten Macht mit Gewalt zu ihren Gunsten zu lösen. Im Oktober 1917 nahm beispielsweise das militärische Revolutionskomitee des Petersburger Sowjets der Arbeiterdeputierten einen Aufstand in Angriff, um die Bestrebungen der Regierung [bürgerliche Übergangsregierung unter dem Kabinett Lwow, später Kerenski, Anm. d. Red.] zu blockieren, den Sowjet zu entwaffnen und aufzulösen.[11] Aber ein Aufstand dieser Art – die Anwendung von Gewalt, um den Vormarsch der Konterrevolution zu blockieren – ist eine konjunkturelle und taktische Frage, die mit konkreten Kämpfen und dem Kräfteverhältnis zu tun hat. Sie ergibt sich aus der strategischen Perspektive des Aufbaus von Institutionen der Arbeiter:innen- und Volksmacht, die immer mehr auf die Autorität des alten Staates übergreifen.
Die Gewaltfrage
So ein Ansatz hat gewiss nichts mit einem Gewaltfetisch zu tun. Das hat schon vor einem Jahrhundert der ungarische Marxist Georg Lukács deutlich gemacht. Indem Lukács die grundsätzliche Rolle der revolutionären Gewalt in der Geschichte anerkannte, betonte er, dass „Gewalt kein autonomes Prinzip sei und niemals sein könne.“ Für Revolutionär:innen, so betonte er, „ist Gewalt nichts anderes als der Wille des Proletariats, das sich bewusst geworden ist und bestrebt ist, die versklavende Herrschaft der verdinglichten Verhältnisse über den Menschen und die Herrschaft der Ökonomie über die Gesellschaft abzuschaffen.“ [Verdinglichung ist ein Begriff, der vor allem durch Lukacs geprägt wurde und meint, dass die sozialen Beziehungen kommodifiziert und somit von ihren Träger:innen, den Menschen, entfremdet werden; Anm. d. Red.] Um seine Position klarzumachen und unmissverständlich von der Idee der Revolution als einem singulären magischen Akt abgrenzen, fügt Lukács noch hinzu: „Diese Aufhebung, dieser Sprung ist ein Prozess.“[12] Kurz gesagt, für revolutionäre Sozialist:innen geht es bei der konzertierten Anwendung von Gewalt um „den Willen des Proletariats“, und sie beinhaltet einen Prozess, durch den Mitglieder der proletarischen Klasse die Gewalt des Kapitals („die versklavende Herrschaft der verdinglichten Verhältnisse“) über ihr Leben eindämmen. Institutionell beinhaltet dies den Aufbau, die Ausweitung und Stärkung neuer Zentren der demokratischen Arbeiter:innen- und Volksmacht von unten.
Miliband, Poulantzas und das Problem der Doppelherrschaft
Neuere Doppelherrschaftsstrategien kamen von zwei Theoretikern, die sich des Scheiterns des Reformismus wohl bewusst waren: Ralph Miliband und Nicos Poulantzas [griechisch-französischer Marxist, der sich wie Miliband mit der Staatsfrage beschäftigte; Anm. d. Red.]. Beide versuchten einen „demokratischen“ (also bürgerlich-parlamentarischen) oder nicht-revolutionären Weg zum Sozialismus zu formulieren. Doch eine ehrliche Bestandsaufnahme zwang beide Autoren letztlich doch dazu, wieder mehr von der Doppelherrschaftsperspektive zu übernehmen, als oft anerkannt wird.
«Ehrlichkeit setzt voraus, dass man anerkennt, dass radikale sozialistische Kräfte in den meisten Teilen der heutigen Welt überwältigend marginal sind – unabhängig davon, ob sie einen links-parlamentarischen Ansatz oder eine Doppelmachtstrategie vertreten.»
In einem kritischen Moment in „Marxismus und Politik“ räumte Miliband zum Beispiel ein, dass eine bei den Wahlen siegreiche linke Regierung unter enormen politischen und wirtschaftlichen Druck geraten würde, ihr Programm zu verwässern und vor den kapitalistischen Spielregeln zu kapitulieren. Um dieses Ergebnis zu vermeiden, wäre ihre einzige Option, sich auf die Massenmobilisierung durch ein „Netzwerk von Organen der Volkspartizipation“ zu verlassen. Und dies, so räumte er ein, beinhalte „eine Anpassung an das Konzepts der ‚Doppelherrschaft’“ – genau das Konzept, das im Mittelpunkt der sogenannten „aufständischen Politik“ steht.[13] Darüber hinaus kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Miliband in öffentlichen Debatten dem revolutionären Standpunkt erhebliche Zugeständnisse abverlangte, besonders wenn es um die tragische Niederlage der Linken in Chile 1973 ging.[14]
Ähnliche „Anpassungen“ an die Doppelmachtperspektive lassen sich in den Schriften von Poulantzas beobachten, der ebenfalls einen Mittelweg zwischen Reform und Revolution suchte. Während er eine Strategie des „demokratischen Sozialismus“ [demokratisch bezieht sich hier auf eine bürgerlich-parlamentarische Interpretation, als Gegensatz zur sozialistischen Basisdemokratie; Anm. d. Red.] befürwortete, räumte Poulantzas ein, dass „der Reformismus beständig eine latente Gefahr“ dastelle und dass die Richtung, die er anstrebe, „wirkliche Brüche“ mit den bestehenden Formen des Staates erfordern würde. Jedoch sollten seiner Meinung nach die parlamentarischen Institutionen von diesen Brüchen ausgenommen werden, da sie, so betonte er, eine „wirkliche Dauerhaftigkeit“ behalten sollten.[15]
Doch gerade als er seinen Frieden mit dem liberalen Parlamentarismus gemacht zu haben schien, wich Poulantzas wieder zurück. Tatsächlich befürwortete er die Idee des „Absterbens des Staates“, eine Idee, die in der revolutionären Tradition zentral ist. Dieses Absterben des Staates, so argumentierte er, „sollte mit der Entwicklung neuer Formen direkter Basisdemokratie und dem Aufblühen von Selbstverwaltungsnetzwerken und -zentren einhergehen“.[16]
Konfrontiert mit der Aussicht, dass eine linke Regierung zur Kapitulation gezwungen werden könnte, wandten sich also sowohl Miliband als auch Poulantzas, um ihr Dilemma zu lösen, an Institutionen der Doppelherrschaft, wenn auch mit einigen Vorbehalten. Und Poulantzas, der sich der entfremdenden Formen des modernen Staates stärker bewusst war, empfahl nachdrücklich „neue Formen der direkten Basisdemokratie“. Jedoch blieb er aus revolutionären Perspektive auf halbem Weg stehen, da es ihm dabei widerstrebte, die liberale Form der parlamentarischen Institutionen hinter sich zu lassen.[17] Und damit kommen wir nun zu der eigentlichen Debatte – nicht der Scheindebatte über einen phantomhaften „Insurrektionismus“.
Wahlen, Massenbewegungen und die Linke
Um diese Debatte zusammenzufassen, werde ich rechtsgerichtete Sozialdemokraten ignorieren, die sich, wie die Geschichte zeigt, auf die Seite der Macht des Kapitals und des Staates stellen werden, wenn es hart auf hart kommt.[18] Die wichtigere Debatte ist diejenige zwischen links-parlamentarischen und revolutionären Strömungen innerhalb der sozialistischen Linken. Und vieles davon hat mit der Brauchbarkeit einer Strategie zu tun, die auf die Schaffung radikal neuer Formen politischer Macht setzt – verwurzelt in Institutionen und Praktiken direkter Basisdemokratie.[19]
Eric Blanc hat behauptet, dass die Unterstützung der Arbeiter:innenklasse für eine solche Strategie „immer marginal geblieben ist“.[20] Und ausserhalb von Momenten der revolutionären Umwälzung in der Gesellschaft ist das sicherlich richtig. Aber dasselbe könnte auch von einer Strategie gesagt werden, die eine linke Regierung wählt, welche sich der Aushöhlung der Macht des Kapitals verschrieben hat und durch eine Kampagne von Generalstreiks und Massenprotesten auf der Strasse gestützt wird. Wie Poulantzas unumwunden zugab: „Die Geschichte hat uns noch kein erfolgreiches Beispiel eines demokratischen Weges zum Sozialismus gegeben.“ [demokratisch meint auch hier nicht demokratisch an sich, sondern dessen bürgerlich-parlamentarische Form; Anm. d. Red.] Sie hat nur „negative Beispiele geboten, die es zu vermeiden gilt, und einige Fehler, über die man reflektieren sollte“.[21] Die schiere Ehrlichkeit setzt voraus, dass man anerkennt, dass radikale sozialistische Kräfte in den meisten Teilen der heutigen Welt überwältigend marginal sind – unabhängig davon, ob sie einen links-parlamentarischen Ansatz oder eine Strategie der Doppelherrschaft vertreten.
«Wir gehen eine Wette ein. Wir spekulieren darauf, dass die Geschichte noch einmal Momente von massenhaften Volksaufständen hervorbringen wird, in denen solche Organisator:innen einen Unterschied machen können. Wofür wir natürlich keine Garantie haben. Aber wenn wir die Kämpfe unserer Zeit durchgehen, können wir noch immer Anzeichen für eine Revolution entdecken.»
Die wirkliche Frage dreht sich daher um die langfristigen strategischen Perspektiven und die Praktiken, die dadurch im Hier und Jetzt prioritär werden. Was heute in den Vereinigten Staaten unbezweifelbar scheint, ist, dass die links-parlamentarische Strömung dem Wahlkampf einen viel höheren Vorrang beimisst (und viel mehr Ressourcen in ihn investiert). Die Befürworter:innen der Doppelherrschaftsstrategie konzentrieren sich hingegen eher auf die Organisierung an der Basis am Arbeitsplatz, den Aufbau von Mieter:innengewerkschaften und -streiks, die Mobilisierung in Solidarität mit #BlackLivesMatter, die Unterstützung internationaler Frauenstreiks, Kampagnen für Queer- und Transrechte, die Mobilisierung für die Solidarität mit Palästina, den Aufbau lokaler Defund-the-Police-Projekte und die Schaffung von Basisorganisationen in Gemeinden und an Arbeitsplätzen. Natürlich beteiligen sich auch viele Menschen im eher wahlorientierten Lager an diesen Arenen, genauso wie viele aus dem Lager der Doppelherrschaft auch spezifische Wahlkampagnen unterstützen – und das bietet einen wichtigen Raum für Aktivist:innen beider Strömungen, um zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen.[22] Aber ungeachtet dieser Überschneidungen gibt es weiterhin signifikante Unterschiede in der Gewichtung und in einer strategischen Priorisierung, die beide Ansätze unterscheidet.
Am Wichtigsten ist, dass die revolutionäre Perspektive zutiefst dem Projekt der Entwicklung von Tausenden von Basisorganisator:innen in Nachbarschaften, Schulen und an Arbeitsplätzen verpflichtet ist. Der Schwerpunkt liegt hier darauf, Aufstandspraktiken von unten her aufzubauen und Aktivist:innen, die Erfahrung in militanter Basisorganisation haben, auszubilden. Das revolutionäre Lager bezweifelt stark, dass eine solche Politik (und einer solchen anhängende Organisator:innen) geschaffen werden kann, indem man sich auf Telefonbanking und Wahlwerbung konzentriert. Wir glauben, dass ein tiefergehendes „Set an Fähigkeiten“ erforderlich ist, wenn ein Kader von Menschen mit der Fähigkeit, einen Massenaufstand zu fördern und zu vertiefen, entwickelt werden soll.[23]
Das bedeutet natürlich, dass wir eine Wette eingehen. Wir spekulieren darauf, dass die Geschichte noch einmal Momente von massenhaften Volksaufständen hervorbringen wird, in denen solche Organisator:innen einen Unterschied machen können. Wofür wir natürlich keine Garantie haben. Aber wenn wir die Kämpfe unserer Zeit durchgehen, können wir noch immer Anzeichen für eine Revolution entdecken.
Revolutionäre Probedurchgänge
Dies bringt mich nun zurück zu den revolutionären Probedurchgängen im Zeitalter des Neoliberalismus. Denn die zentrale Frage, welche sich durch das Buch Revolutionary Rehearsals zieht, dreht sich um die anhaltende Relevanz revolutionärer Politik in der heutigen Welt. Die Herausgeber:innen und Autor:innen sind sich der Gründe für die Zweifel diesbezüglich durchaus bewusst. Sie weichen den erheblichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht aus. Sie weigern sich, sich auf rituelle Formeln aus 1917 oder Kniefälle vor Lenin zurückzuziehen.
In der Anerkennung, dass das Problem der Revolution letztlich eines der realen historischen Bewegungen, Kämpfe und Erfahrungen ist, untersucht Revolutionary Rehearsals tatsächliche Massenumwälzungen während der gesamten neoliberalen Periode, um zu analysieren, was von der marxistischen Idee der Revolution übrig geblieben ist. In einer Reihe von eindringlichen Studien erforscht es die Dynamik von Arbeiter:innen- und Volksprotesten von den Aufständen in Osteuropa 1989 bis zur ägyptischen Revolution von 2011. Dabei analysieren die Autor:innen Massenkämpfe in Südafrika, Indonesien, Bolivien, Argentinien und die regionalen Dimensionen der Bewegungen in Lateinamerika wie auch im subsaharischen Afrika. Sie kommen so zum Schluss, dass alle diese grossen Revolten trotz der immensen Schwierigkeiten „neue Impulse und neue Möglichkeiten“ für die radikale Linke eröffnen. Damit finden sie sich auf der gleichen Seite wieder wie Susan Buck-Morss mit ihrem Buch Revolution Today. Buck-Morss zeigt sowohl anhand von Fotos von Volksaufständen wie auch anhand von Texten, dass revolutionäre Bestrebungen in der heutigen Welt keineswegs verschwunden sind.[24] […] In den Worten von Buck-Morss bedeutet das Fortbestehen des revolutionären Impulses, dass „die Geschichte offen für Rettung bleibt“.[25]
Die jüngsten Massenaufstände in Kolumbien und in Palästina zeigen, dass unsere Welt verzweifelt nach revolutionärer Transformation schreit. Wir sind der Überzeugung, dass letztere eine frische kritische marxistische Analyse erfordert.
Dieser Text wurde im Original im Juni 2021 erstveröffentlicht auf Spectre. Die Redaktion der BfS – Bewegung für den Sozialismus hat den Text übersetzt und leicht bearbeitet.
[1] Crucially, as they put it one year after the Parisian uprising, the Commune demonstrated that “the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes.” See Karl Marx and Frederick Engels, Preface to a new German edition of The Communist Manifesto as cited in Engels’s Preface to the 1888 English edition of that text. Available in Karl Marx and Frederick Engels, “The Manifesto of the Communist Party” in Karl Marx, The Revolutions of 1848 (Harmondsworth: Penguin Books, 1973), 66.
[2] David McNally, “The Return of the Mass Strike: Teachers, Students, Feminists, and the New Wave of Popular Upheavals,” Spectre 1, no. 1 (Spring 2020): 12-37.
[3] Colin Barker, Neil Davidson, and Gareth Dale, “Introduction” to Revolutionary Rehearsals in the Neoliberal Age (Chicago: Haymarket Books, 2021), 5.
[4] To be clear, there are many different shades of opinion in DSA, not all of them embracing the legacy of Kautsky. The key popular text of the new Kautskyism is Eric Blanc, “Why Kautsky Was Right (and Why You Should Care),” Jacobin, April 2, 2019. I cannot discuss here the degree to which the new Kautskyism relies on tendentious criticism of the legacy of Rosa Luxemburg.
[5] See David McNally and Charles Post, “Beyond Electoralism: Mass Action and the Remaking of the Working Class,” Spectre 2, no. 1 (Spring 2021). As we point out there, it has been the overwhelming attitude of revolutionary socialists to favor participation in parliamentary politics, but not to support elevating such work above building mass strikes and struggles in working class communities.
[6] The term “passive radicalism” was used in 1912 by the left radical Anton Pannekoek to characterize Kautsky’s politics. Kautsky accepted the term with respect to specific forms of mass strikes and street demonstrations in an article entitled “The New Tactic.” See Kautsky, “Die neue Taktik,” Die Neue Zeit 30, no. 2 (1912): 695. Available at https://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1912/xx/taktik.htm. For an English translation of this passage see Anton Pannekoek, “Marxist Theory and Revolutionary Tactics” in Pannekoek and Gorter’s Marxism, ed. D.A. Smart (London: Pluto Press, 1978): 64. For the record, I consider Pannekoek’s pre-World War 1 critique of Kautsky to be highly insightful, notwithstanding his later embrace of (“abstentionist”) positions on parliamentary activity and work in mass trade unions from which I dissent.
[7] For a few helpful critical pieces see Charlie Post, “The ‘Best’ of Kautsky isn’t Good Enough,” Jacobin, March 9, 2019; Mike Taber, “Kautsky, Lenin and the Transition to Socialism: A Reply to Eric Blanc,” available at https://johnriddell.com/2019/04/06/kautsky-lenin-and-the-transition-to-socialism-by-mike-taber/; Gil Schaeffer, “The Curious Case of the ‘Democratic Road to Socialism’ That Wasn’t There,” New Politics, April 24, 2020.
[8] A claim made by Blanc, “Why Kautsky Was Right.”
[9] Ralph Miliband, Marxism and Politics (Oxford: Oxford University Press, 1977), 155, 166, 169.
[10] See David McNally, “Race, Class, the Left, and the US Elections, Studies in Political Economy, forthcoming 2021.
[11] See the detailed discussion in China Mieville, October: The Story of the Russian Revolution (London: Verso Books, 2017), 270-90. See also Alexander Rabinovitch, The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd (New York: W.W. Norton, 1976), Ch. 13-15.
[12] Georg Lukacs, History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, trans. Rodney Livingstone (London: Merlin Press, 1971), 251-52.
[13] However, Miliband imagined organs of popular power, like workplace and neighborhood councils, acting in a “supportive” relation to a left-leaning parliamentary regime, not encroaching upon its powers. See Marxism and Politics, 188.
[14] I say this based on my own exchange with Miliband at an event, chaired by Ellen Meiksins Wood, at Glendon College, Toronto in early 1979. I will discuss this exchange at the special event for Spectre editors and sustainers on “Revolutionary Rehearsals” on June 30, 2021.
[15] Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, new edition (London: Verso Books, 2000), 258, 261.
[16] Poulantzas, State, Power, Socialism, 261-62.
[17] The exact relation between institutions of parliamentary and direct democracy is a concrete question that can only be resolved in specific circumstances. It is not terribly difficult to imagine, however, that a US Congress elected prior to a mass upheaval might become a deliberate block on the advance of popular power.
[18] See for instance, Ian Birchall, Bailing Out the System: Reformist Socialism in Western Europe 1944-1985 (London: Bookmarks, 1986).
[19] Contrary to a lazy claim, this has nothing to do with disavowing all forms of political representation. As the Paris Commune, the soviets of 1917, and other experiences demonstrate, council-style democracy involves elections. Recallable delegates of the people do indeed represent those who elected them. It is simply that they are subject to much more effective forms of mass pressure and accountability, including recall.
[20] Blanc, “Why Kautsky Was Right.”
[21] Poulantzas, State, Power, Socialism, 265.
[22] The latter is true of Leninists as well. As Miliband noted (Marxism and Politics, 163), “Leninism was not a revolutionary strategy hostile to parliamentary participation.”
[23] See McNally and Post, “Beyond Electoralism.”
[24] Susan Buck-Morss, Revolution Today (Chicago: Haymarket Books, 2019).
[25] Buck-Morss, Revolution Today, 62.