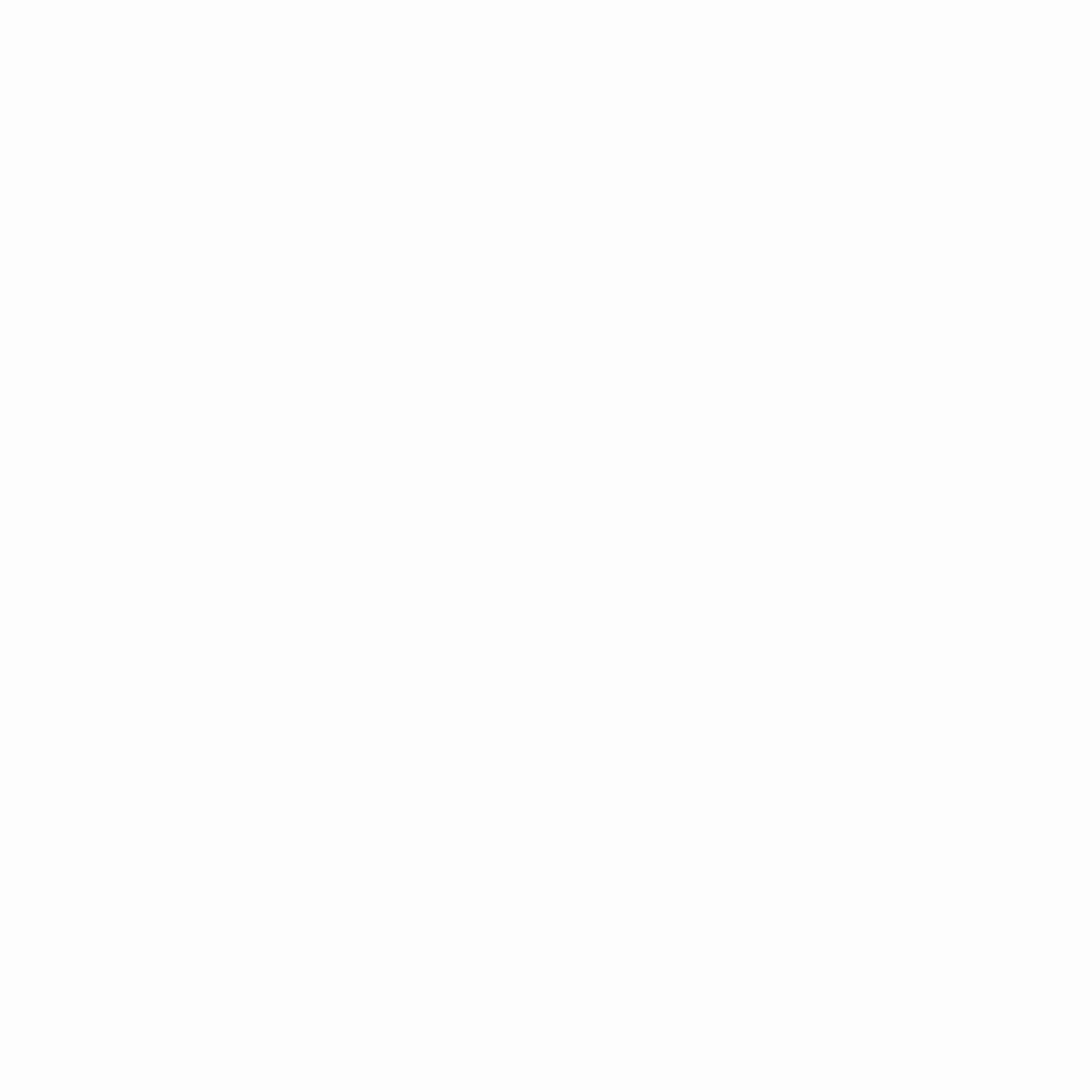Share This Article
Die tiefe und keineswegs ausgestandene Krise der kapitalistischen Finanz- und Realwirtschaft hat auch zu einer Debatte über die Zukunft und Perspektiven des Systems geführt. Dabei gibt es auf bürgerlicher Seite einmal Autoren, die einzig im (kapitalistischen) Wachstum die Möglichkeit und Chance sehen, «den Wohlstand zu halten und die ökologischen Probleme zu meistern». Auf der anderen Seite stehen die Fortschrittsskeptiker, die auf die Endlichkeit der Ressourcen, die drohende Klimakatastrophe und die «Grenzen des Wachstums» (Club of Rome, 1972) verweisen. Ideologisch betrachtet sind die Wachstumstheoretiker natürlich eher auf der Seite der verschiedenen Spielarten des (Neo-)Liberalismus zu verorten, während seine Kritiker mehrheitlich dem (wert-) konservativen Lager zuzurechnen sind. In der Diskussion geht es auch um die Frage, ob und wie Wachstum und Fortschritt zusammenhängen und ob vom wirtschaftlichen Wachstum auf den Fortschritt der Menschheit geschlossen werden kann. Den Hintergrund bildet die tiefe Legitimationskrise des Neoliberalismus, der ja in den 1970er Jahren mit dem Versprechen angetreten war, durch eine Politik der Deregulierung, der Privatisierung und des Sozialabbaus die «Wachstumskräfte» so stärken zu können, dass eine neue Phase wirtschaftlicher Prosperität eingeläutet würde.
Schöpferische Zerstörung
Karl-Heinz Paqué: Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus. München: Hanser, 2010, 280 S., 19,90 Euro.
Beginnen wir mit dem Buch des Magdeburger Professors Karl-Heinz Paqué, der im Titel «Wachstum» mit Ausrufezeichen schreibt und schon dadurch seinen Standpunkt deutlich macht. Paqué war von 2002 bis 2006 für die FDP Finanzminister in Sachsen-Anhalt, bevor er wieder an die Universität zurückging. Er ist Schüler von Herbert Giersch, dem langjährigen Leiter des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (dem das Buch auch gewidmet ist), das ja durch seine eindeutig neoliberal ausgerichteten Analysen und Empfehlungen bekannt ist. Das Besondere an Paqué ist allerdings, dass er weniger in der Nachfolge von Ludwig von Mises oder Friedrich von Hayek steht, den eigentlichen Vordenkern des Neoliberalismus, sondern viel stärker von Joseph Schumpeter beeinflusst ist, dem dritten wichtigen Vertreter der «österreichischen Schule» der Nationalökonomie. Während jene im Sozialstaat bereits den Beginn des Sozialismus sahen und ihn de facto zugunsten einer Art Armenfürsorge abbauen wollten, sah Schumpeter durchaus die Notwendigkeit von sozialem Ausgleich für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Für Schumpeter lag der Schlüssel der ökonomischen Entwicklung in den Wellen der Innovationen, die durch «schöpferische Zerstörung» den alten Produktionsapparat umwälzen.
Paqués Buch besteht aus fünf nicht stringent miteinander verbundenen Teilen, die sich mit den «Kräften des Wachstums», «den «Grenzen des Wachstums», den «Risiken der Finanzmärkte», dem «Wandel des Sozialstaates» und der «Zukunft des Kapitalismus» befassen. Die Grundthese von Paqué lautet in etwa so, wie sie ähnlich auch in den meisten Parteiprogrammen von rechts bis links zu finden ist und von zahlreichen führenden Vertretern der im Bundestag agierenden Parteien rauf und runter gebetet werden: Wirtschaftliches Wachstum ist der einzige Weg, um weltweit die «großen Ziele der Menschheit» zu erreichen und auf Dauer «Lebensqualität und soziale Sicherheit» gewährleisten zu können. Ein Verzicht auf Wachstum wäre daher nicht nur wirtschaftlich und politisch falsch, sondern auch ethisch nicht zu rechtfertigen, weil ohne Wachstum die großen sozialen und ökologischen Probleme der Menschheit unmöglich gelöst werden können. Im Unterschied zu Deregulierern und Privatisierern legt er sein Hauptaugenmerk auf die technologische und arbeitsorganisatorische Innovation mit Betonung des industriellen Bereichs.
Laut Paqué sind es vor allem drei Gründe, weswegen das Wirtschaftswachstum ins Gerede gekommen ist, nämlich zunächst natürlich die weltweite Finanzkrise, die der Wachstumsgläubigkeit einen kräftigen Dämpfer versetzt habe, sodann die intensivere Beschäftigung mit den ökologischen Folgen, vor allem dem Klimawandel, und schließlich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Denn Wachstum und Globalisierung werden als die wesentlichen Quellen für die Zunahme der Unterschiede bei Einkommen und Lebenschancen und die sich dadurch immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich ausgemacht. Hinzu kommen dann noch der Kulturpessimismus, der den globalen Menschen als eine Art wurzellosen Durchschnittsamerikaner sieht – «angepasst, auswechselbar, irgendwie seiner Identität beraubt, vielleicht wohlhabend, aber unglücklich, eine verkümmerte Kreatur, jämmerlich gestrandet in der kulturellen Armut auf der ewigen hastigen Suche nach materiellem Reichtum». Schließlich, so meint der Autor, trage auch die demografische Entwicklung zur Wachstumsskepsis bei – es entstehe «das bedrohliche Bild eines kollektiven Altersheims».
Der Autor setzt solchen Thesen seine wirtschaftshistorischen Argumente entgegen. Der materielle Wohlstand wachse mindestens seit 1820 schneller als die Weltbevölkerung; die globale Produktion habe sich seither um das 58-fache vermehrt, oder um 1,2% pro Jahr, bei einem Anstieg der Weltbevölkerung von etwa 1%. Zwischen 1500 und 1800 habe sich die Produktionsleistung nur um 0,32% erhöht. Die Industrialisierung habe nicht nur die Grundlage für einen unerhörten Schub bei den Wohlstandsgewinnen gelegt, sondern sei auch das Zentrum der entscheidenden Innovationen geworden, die sich dann auch in die Landwirtschaft und den Dienstleistungsbereich fortgepflanzt hätten. Lange Zeit habe es so ausgesehen, als bliebe dieser «entfesselte Prometheus» (David Landes) der Industrialisierung ein westliches Privileg. Nur Japan hatte es noch frühzeitig geschafft, diesem Weg nachzueifern. Doch seit den 1970er Jahren habe sich diese Situation grundlegend verändert, denn nach einigen kleinen Tigern haben sich seit dreißig Jahren große Länder wie China, Indien, Indonesien und Brasilien auf den Weg der Industrialisierung begeben. Und weil sie auf bereits vorhandenes Wissen und Technologie zurückgreifen könnten, verlaufe ihr Aufstieg weit schneller als im Europa (und in den USA) des 19. Jahrhunderts. Sofern sie über gut ausgebildete Bevölkerungsschichten verfügten, könnten sie das vorliegende technische Wissen auch schnell in Fortschritte der Arbeitsproduktivität umsetzen. Der Industrialisierungsprozess dehne sich also von der «Kleinen Welt» (im Wesentlichen der Westen) auf die «Große Welt» und damit auf die Mehrheit der Weltbevölkerung aus. Dieser Prozess des Übergangs wird heute im Allgemeinen Globalisierung genannt. Diese sei alternativlos, denn alle Versuche der direkten oder indirekten Abschottung vom Weltmarkt – der Protektionismus nach dem Ersten Weltkrieg, die Planwirtschaft oder die Politik der Importsubstitution – seien letztlich gescheitert. Auch die diversen Theorien, wie sie etwa ein Gunnar Myrdal in «Asian Drama» formuliert habe, wonach die asiatischen Gesellschaften aus kulturellen Gründen in einem «Teufelskreis der Stagnation» befangen und nicht in der Lage seien, dem westlichen Pfad zu folgen, haben sich als falsch erwiesen. Darin kann man dem Autor zustimmen und anfügen, dass auch die heute in zahlreichen Publikationen auftauchenden, im Grunde rassistischen Vorurteile der islamischen Welt gegenüber in absehbarer Zeit faktisch widerlegt sein werden.
Ein Verzicht auf Wachstum bedeute somit einen «Verzicht auf die Umsetzung von neuem Wissen in eine qualitativ bessere und vielfältigere Produktwelt, und zwar privatwirtschaftlich und gemeinnützig». Dies sei eine merkwürdige Forderung, denn warum sollten die Entwicklungsländer auf den Wohlstand der «Kleinen Welt» verzichten?
Was könnte die insgesamt optimistischen Ausblicke des Autors eintrüben? Er glaubt zwar, dass das Risiko einer Klimakatastrophe durch technologische Innovation minimiert und die Risiken von Finanzkrisen durch Regulierungen mittels strenger nationaler Finanzaufsicht und deren internationale Koordination abgesenkt werden können. Er möchte aber nicht ausschließen, dass es aufgrund der Klimakrise zu «einer Großkatastrophe mit irreversiblen fatalen Folgen kommt» oder dass von den Finanzmärkten «eine Weltwirtschaftskrise mit massiver Stockung des Geldkreislaufs und anschließenden politischen Wirren, wie sie sich in der Zwischenkriegszeit abspielten», ausgehen könnte. Weitere, im Buch nicht weiter behandelte «Risiken» wären die Möglichkeit atomarer Vernichtung, Terroranschläge jeder Art, evtl. auch mit Massenvernichtungswaffen, der unverantwortliche Einsatz der Biotechnologie zum Klonen von Menschen, der auf der modernen Informationstechnologie gegründete totale Überwachungsstaat usw. Einer wirtschaftlich und wissensmäßig wachsenden Welt eröffneten sich auch immer größere Möglichkeiten zum Missbrauch. Es sei die Aufgabe des demokratischen Staates, durch «gutes Regieren» einen Weg zu finden, Missbräuche zu verhindern und die ungeheuren Möglichkeiten nach moralischen Gesichtspunkten einzugrenzen.
Ein Hoch auf die Moral!
Klaus Schweinsberg: Sind wir noch zu retten? Warum Staat, Markt und Gesellschaft auf einen Systemkollaps zusteuern. München: Finanz-Buch-Verlag, 2010, 235 S., 19,95 Euro. Meinhard Miegel: Exit. Wohlstand ohne Wachstum. Berlin: Propyläen, 2010, 300 S., 22,90 Euro.
Konservative Wachstumskritiker haben seit einiger Zeit Konjunktur. In der Regel geht es bei ihnen um drohende Inflation oder Staatsbankrott, den Zusammenbruch des Euro, vor allem aber um den angeblichen Verfall moralischer Werte.
Klaus Schweinsberg, der Leiter der Intes Stiftung für Familienunternehmen, fragt, ob wir noch zu retten sind, und behauptet, Staat, Markt und Gesellschaft steuerten auf einen Systemkollaps zu. Er benennt zahlreiche politische, gesellschaftliche und kulturelle Faktoren, die bewirkten, dass der «Wohlfahrtsstaat» immer mehr von seiner Tragfähigkeit einbüße. Besonders wichtig seien der Rückzug ins Private und die sich ausbreitende Ohne-mich-Haltung. Das Gegenrezept ist im Grunde altbekannt: moralische Aufrüstung! Der Autor möchte durchsetzen, dass der ehrenamtliche Einsatz des Einzelnen für die Gesellschaft Pflicht wird. Führungspersonal voran. Besonders schön sein Vorschlag, Vorstandsmitglieder der DAX-Konzerne sollten an mehreren Tagen im Jahr soziale Dienste in Suppenküchen oder Altersheimen absolvieren. Da würde bei den Acker-, Groß- oder Obermännern sicherlich Freude aufkommen!
Ein besser durchdachtes Beispiel wertkonservativer Wachstumskritik hat der langjährige Vorsitzende des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft, Meinhard Miegel, in seinem neuen Buch Exit. Wohlstand ohne Wachstum abgeliefert. Er beginnt mit der durchaus zutreffenden Diagnose, dass «große Teile der Welt – an ihrer Spitze die frühindustrialisierten Länder Europas, Nordamerikas, Japan, Australien und einige andere – am Wirtschaftswachstum (hängen) wie Alkoholiker an der Flasche oder Drogensüchtige an der Nadel. Stockt der Nachschub auch nur kurzzeitig, werden sie von Panikattacken befallen und von existenziellen Ängsten geplagt.» Vielleicht sind es jedoch nicht die «Länder», sondern ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die so heimgesucht werden. Und angesichts der in der Krise freigesetzten Massen von Arbeitslosen hat der Professor leicht reden.
Genüsslich zitiert Miegel Reden und Programme von Politikern aller großen Parteien, die mehr Wachstum als Ausweg aus der Wirtschaftskrise einfordern: «Wir müssen alles tun für mehr Wachstum. Wir müssen in diesem Land bereit sein, möglichst hohe Wachstumsraten zu erzielen» (Angela Merkel). Und die FDP fordert natürlich eine «Wirtschaftspolitik, die Wachstums schafft» – am besten durch Steuersenkungen. Auch Grüne und Linke möchten das Wachstum «ankurbeln» – durch einen grünen New Deal oder durch Ausbau des Sozialstaats. Da sich das Wachstum von selbst so gar nicht einstellen will, greifen fast alle Staaten zu «hemmungslose(r) Schuldenmacherei».
Miegel spricht von der Finanzkrise des «Casinokapitalismus» als einem «Fest, das da gefeiert wurde», welches «aus der Sicht der Ökonomen das gigantischste kreditfinanzierte Konjunkturprogramm (war), das es je gegeben hat. Dessen sollte sich jeder bewusst sein, der sich auch nur mit dem Gedanken an ein neues derartiges Programm trägt – und seine Folgen bedenken.» Er bringt dann eine kurze Analyse des US-amerikanischen Immobilienbooms und des Verkaufs von Kreditderivaten und Bankzertifikaten an die ganze Welt. «Das zwar traurige, aber vorhersehbare Ergebnis (war) eine Entwicklung, die fatale Übereinstimmung mit einem Kettenbrief aufwies.»
Und er fährt fort: «Solche Zusammenbrüche sind Teil der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der Spiel und Wette eine wichtige Rolle zukommen.» (Wo er Recht hat, hat er Recht!) «Allein seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es mindestens fünf solcher spiel- und wettgetriebenen Wirtschafts- und Finanzkrisen, vom Schwarzen Montag 1987 über die Asien- und diversen Südamerikakrisen bis hin zur Krise der New Economy zu Beginn dieses Jahrzehnts. Der Mensch ist offenbar ein Spieler. Bekommt er Gelegenheit hierzu, gibt es kein Halten mehr. Dann spielen Staaten, Banken und Versicherungen, Pensionsfonds, Kleinaktionäre und Sparer, dann spielen Amerikaner und Europäer, Russen und Chinesen, die Völker entwickelter und weniger entwickelter Länder, dann spielen einfach alle. Die Globalisierung hat das Feld dafür bereitet.» Der Fehler in dieser Argumentation liegt darin, dass die Begriffe «Kapitalismus» und «Mensch» einfach in eins gedacht werden. Sicherlich hat sich seit der neoliberalen Wende Anfang der 1980er Jahre ein finanzmarktgetriebener Kapitalismus entwickelt, aber nicht weil «der Mensch» ein Spieler ist (denn die übergroße Mehrheit der Menschen ist ja nur als Opfer beteiligt), sondern weil nach der Liberalisierung der Finanzmärkte ganz bestimmte Leute geglaubt haben, mit Hilfe moderner Mathematik und Computertechnologie könne es gelingen, die Risiken der Kreditgewährung und deren «Umbau» zu als «Wertpapiere» handelbaren Finanzderivaten im Griff zu behalten. Vertraut haben sie auf ihre neoliberalen Ideologeme von der «unsichtbaren Hand», die das Marktgeschehen letztlich vernünftig lenke. Es handelt sich einmal mehr um Goethes Zauberlehrling, an dessen Übereifer schließlich der Besen schuld haben soll.
Nun kommt Miegel auf die wesentliche Frage der Bedürfnisse zu sprechen. Ohne eine genauere Analyse der Bedürfnisstrukturen anzubieten, gelangt er zu der Schlussfolgerung, dass in Ländern wie Deutschland Wachstum und Zufriedenheit längst auseinanderfallen, weil die Grundbedürfnisse, nämlich ausreichend zu Essen und zu Trinken zu haben, über genügend Kleidung zu verfügen und seine Wohnwünsche befriedigen zu können, im Wesentlichen gestillt seien. Man wird ihm zustimmen können, wenn er sagt: «Keiner möchte hungern oder frieren. Aber nur wenige fühlen sich glücklicher, wenn sie einen Zobelpelz tragen oder einen Maybach fahren.» Daher stieg in Deutschland die Lebenszufriedenheit nach dem Krieg parallel mit der Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) etwa bis 1970 an. Damals erklärten gut 60% der Bevölkerung, sie seien mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden. Seither verdoppelte sich das BIP, und die verfügbaren Einkommen liegen etwa 75% höher – doch der Anteil der Zufriedenen schwankt weiterhin um die 60%. «So erklärten im Jahre 2007 in Deutschland nur 27% der Befragten, sie erstrebten eine Mehrung ihres materiellen Besitzes. 59% bekundeten hingegen, sie seien mit dem, was sie haben, zufrieden, und weitere 10% – recht gleichmäßig verteilt über alle Einkommensschichten –, waren sogar bereit, mit weniger vorliebzunehmen.» Bei der Frage, was den Menschen im Leben wichtig sei, standen die Pflege von Freundschaften (87%), intakte Familienverhältnisse (81%) oder ein erfüllter Beruf (75%) ganz oben. In den meisten «frühindustrialisierten Ländern» liegen die Verhältnisse ähnlich, und Miegel stellt die (durchaus nachvollziehbare) Behauptung auf, dass Einkommenszunahme und Wohlbefinden nur bis etwa 20000 Dollar im Jahr korrelieren und darüber weitere materielle Güter «nur noch einen geringen und bei vielen überhaupt keinen Beitrag mehr zur Steigerung von Lebenszufriedenheit und Lebensglück» leisten.
Den Zusammenbruch des realen Sozialismus bezeichnet Miegel als «Menetekel» für die frühindustrialisierten kapitalistischen Länder, denn beide System seien in einem Punkt gleich gewesen: «Ihr gemeinsames Glücks- und Heilsversprechen war die Mehrung materiellen Wohlstands für alle.» Der Westen dürfe sich keine Illusionen machen: «Obsiegt hat nicht sein Wertesystem, sondern seine materielle Überlegenheit.»
Meinhard Miegel geht dann auf die ökologische Krise ein und verweist (zu Recht) darauf, dass es schon immer Kritiker des rigiden Wachstumsprozesses mit seinen verheerenden Folgen für Mensch und Natur gegeben hat, die schon frühzeitig auf «die Endlichkeit der Ressourcen, Umwelt und Natur oder auf die drohende Beschädigung des sozialen Zusammenhalts hingewiesen haben». Inzwischen habe sich die Umweltkrise so weit ausgewachsen, dass man die Gefährdungen und Krisenerscheinungen nicht länger verdrängen könne. Außerdem gäbe es deutliche Tendenzen zu einer Sättigung des Wachstums, die absoluten Zuwächse seien überall rückläufig.
So interessant und richtig Miegels Diagnose häufig ausfällt, so einseitig und kurzsichtig sind seine Therapievorschläge. Hier tritt der knallharte Neoliberale auf die Bühne, der sich im Grunde keine Gesellschaft jenseits des bürgerlich-kapitalistischen Modells vorstellen kann. Sicherlich lassen sich viele «Barrieren zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, Freizeit und Erwerbszeit, Privatem und Beruflichem» abbauen – sofern die Logik der Profitmaximierung nicht tangiert wird. Die Frage ist nur, wer unter gegebenen Bedingungen davon profitiert. Miegel zitiert Daniel Bell, der betont hat, dass der «Mensch als Produzent asketisch, genügsam und rechenhaft» sein müsse, als Konsument hingegen «hedonistisch, ausschweifend und exzessiv». Im Unterschied zu Miegel trat Bell aber für die Abschaffung des Kapitalismus ein, denn wie sollte dieser Widerspruch sonst gelöst werden können? Im Grunde möchte Miegel eine Art Verallgemeinerung der Ich-AG, den neuen Selbstständigen, der sich seine eigene Erwerbsgrundlage schafft. Als Flankierung solle die «Politik die Bürger darauf vorbereiten, dass sie künftig nicht mehr die gewohnten Sozialleistungen erhalten werden».
Und wer soll die Lasten der zunehmenden Prekarisierung auffangen? Na, natürlich die Familie! «Während staatliche Systeme in Umbruchsituationen an Handlungsfähigkeit einbüßen und nicht selten auch scheitern, zeigt der Familienverband gerade dann seine besondere Stärke … Die Familien werden viel von dem auffangen müssen, was dem Staat entgleitet.» Und wenn die unter den Lasten stöhnende Familie noch ein Leitbild braucht, dann ist es die Nation: Miegel meint tatsächlich, mit einer Renationalisierung den zentrifugalen Kräften der Globalisierung begegnen zu können.
Fetisch Wachstum
Ernest Mandel: Macht und Geld. Eine marxistische Theorie der Bürokratie. Köln: Neuer ISP Verlag, 2000, 318 S., 21,50 Euro. Peter Radt: Fetisch Wachstum. Philosophisch-ökonomische Anmerkungen zur Logik des Kapitalismus. Köln: Neuer ISP Verlag, 2010, 159 S., 17,80 Euro.
Im Hinblick auf eine marxistische Kritik an diesen einseitigen und bisweilen verqueren Vorstellungen empfiehlt es sich, Ernest Mandels Buch Macht und Geld, besonders das letzte Kapitel über «Selbstverwaltung, Überfluss und das Absterben der Bürokratie» zur Hand zu nehmen. Mandel zeigt auf, wie eine auf der Grundlage der gesellschaftlichen Bedürfnisse aufgebaute Produktion funktionieren könnte und welche Möglichkeiten es gäbe, den Stoffwechsel mit der Natur durch demokratische Planung zu regeln.
Zur Wachstumsproblematik im Kapitalismus hat der Kölner Philosoph Peter Radt mit Fetisch Wachstum ein erhellendes Buch veröffentlicht, das auf marxistischer Grundlage vom grundlegenden Widerspruch dieses Systems ausgeht, nämlich dass nicht (wie in vorkapitalistischer Zeit die Hungersnöte) ein Mangel an Gebrauchsgütern periodische Krisen hervorruft, sondern die periodische Überproduktion von Tauschwerten.
Unter kapitalistischen Bedingungen wird die Wirtschaft von einem Mittel zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, vor allem Nahrung, Kleidung und Wohnung, zu einem Selbstzweck. Denn die innere Logik der Produktionsentwicklung ergibt sich aus dem fortwährenden Streben nach maximalem Profit bzw. im Fall der Großunternehmen nach Extraprofit. Auch die Menschen werden dieser Logik unterworfen; nicht zufällig spricht man von ihnen als «Humankapital». Teilweise gelingt es den «ideologischen Apparaten» der bürgerlichen Gesellschaft, diese Logik fest in den Hirnen einer Bevölkerungsmehrheit zu verankern. In den Bildern der Medien ergeben sich Krisen dann nicht aus dem Widerspruch zwischen Produktion von Gütern und der – im Hinblick auf die kaufkräftige Nachfrage – fehlenden Absatzmöglichkeit, sondern aus moralischem Versagen, der berühmten «Gier der Banker und Finanzhaie». Als würden diese moralischen Defekte im realen Kapitalismus nicht immer am Werke sein! Diese Form der Kritik verwechselt den Kapitalismus und seine Systemlogik mit den Kapitalisten und deren (defizitärer) Moral.
«Ein Kapitalist schlägt viele andere tot», schrieb Marx lakonisch über «den Wettbewerb». Man vergisst nur zu gern, dass die im System wirkende Konkurrenz zwangsweise dazu führt, dass die unterlegenen Konkurrenten vernichtet werden (hierin liegt ja der wirkliche Sinn der Krise) und dass das Kapital durch Entwertung von Kapital und Arbeit versucht, die Profitrate in die Höhe zu treiben. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit und die Tendenz zur «schöpferischen Zerstörung», also zur permanenten Innovation, sowie die Forderung, mehr Geld in Wissenschaft und Forschung zu investieren («Köpfe sind unser einziger Rohstoff»), ohne dass ausreichend Zeit bliebe, über die sozialen und die ökologischen Folgen der Innovation nachzuforschen. Ein besonders drastisches Beispiel für diese Tendenz stellt die Gentechnologie dar.
Mit Verweis auf Aristoteles betont Radt, dass die Arbeit des Menschen um des bloßen (Über-)Lebens willen entstanden ist, dass die Freiheit aber erst dann wirklich entsteht, wenn die Grundbedürfnisse des Menschen gestillt sind. Er dann stellt sich die Frage nach dem guten Leben immer drängender, weil die Leere der kapitalistischen Glücksversprechen immer stärker erfahren wird. «Ein Tun, in dem es ausschließlich um den materiellen Nutzen geht, ist letztlich ein geistloses Tun!» Das Maß der menschlichen Entwicklung ist die freie Zeit, die Zeit der Muße, in der der Mensch nicht äußerlichen Notwendigkeiten oder gar kapitalistischer Entfremdung unterworfen ist. Engels sprach von der Geschichte der in Klassen gespaltenen Gesellschaften als der «Vorgeschichte der Menschheit», die dann zu Ende geht, wenn das Ziel der menschlichen Praxis nicht mehr das Haben, sondern das Sein ist, also die allseitig und harmonisch entwickelte Persönlichkeit. Echte humane Tätigkeit wäre demnach nicht «bloße Erwerbsarbeit oder bloßer Konsum», sondern «wahrhaft erfülltes Tun», dessen spezifisches Kennzeichen «gerade die innere Lebendigkeit und Anteilnahme der Person ist». So wie Goethe im Faust sagt: «Erquickung hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt!»
Die Durchsetzung einer menschlichen Gesellschaft ist nur in Form, um mit Marx zu sprechen, eines Systems «frei assoziierter Produzenten» denkbar. Dass dazu der Kapitalismus als verallgemeinerter Warenwirtschaft, dessen Herzstück die «private Verfügungsgewalt über die gesellschaftlichen Produktionsmittel» ist (auch «freies Unternehmertum» genannt), abgeschafft werden muss, versteht sich von selbst. Der Kapitalismus treibt diesen Prozess jedoch selbst voran, indem er durch immer größere Konzerne (die 500 größten machen bereits zwei Drittel des Welthandels aus) objektiv die «Vergesellschaftung des Produktionsprozesses» vorantreibt. Der Markt wird zurückgedrängt, denn der Austausch zwischen den verschiedenen Konzernteilen erfolgt natürlich nicht nach Marktpreisen, sondern nach konzerninterner Verrechnung.
Wenn die Wirtschaft gemäß den Grundsätzen der Bedürfnisbefriedigung und des gesellschaftlichen Nutzens organisiert würde, käme es zu einem «Absterben der Warenwirtschaft», denn immer mehr Güter können dann ohne Tauschlogik, also gratis verteilt werden. Mit der Warenwirtschaft würde natürlich auch das Lohnsystem Zug um Zug überwunden. Durch die Ausweitung der freien Zeit hätten die Menschen ganz andere Möglichkeiten als heute, sich um die Kinder und die Alten zu kümmern; vor allem aber könnten sie sich intensiv den Aufgaben der gesellschaftlichen und politischen Gestaltung widmen und bräuchten sie nicht wenig kontrollierbaren Vertretern zu überlassen.
Eine sehr gute philosophische Untersuchung der ideologischen Annahmen und Grundlagen der liberalen bzw. neoliberalen Theorie bringt Joseph Vogl: Das Gespenst des Kapitals. Zürich: diaphnes, 2010 (bereits diverse Auflagen).