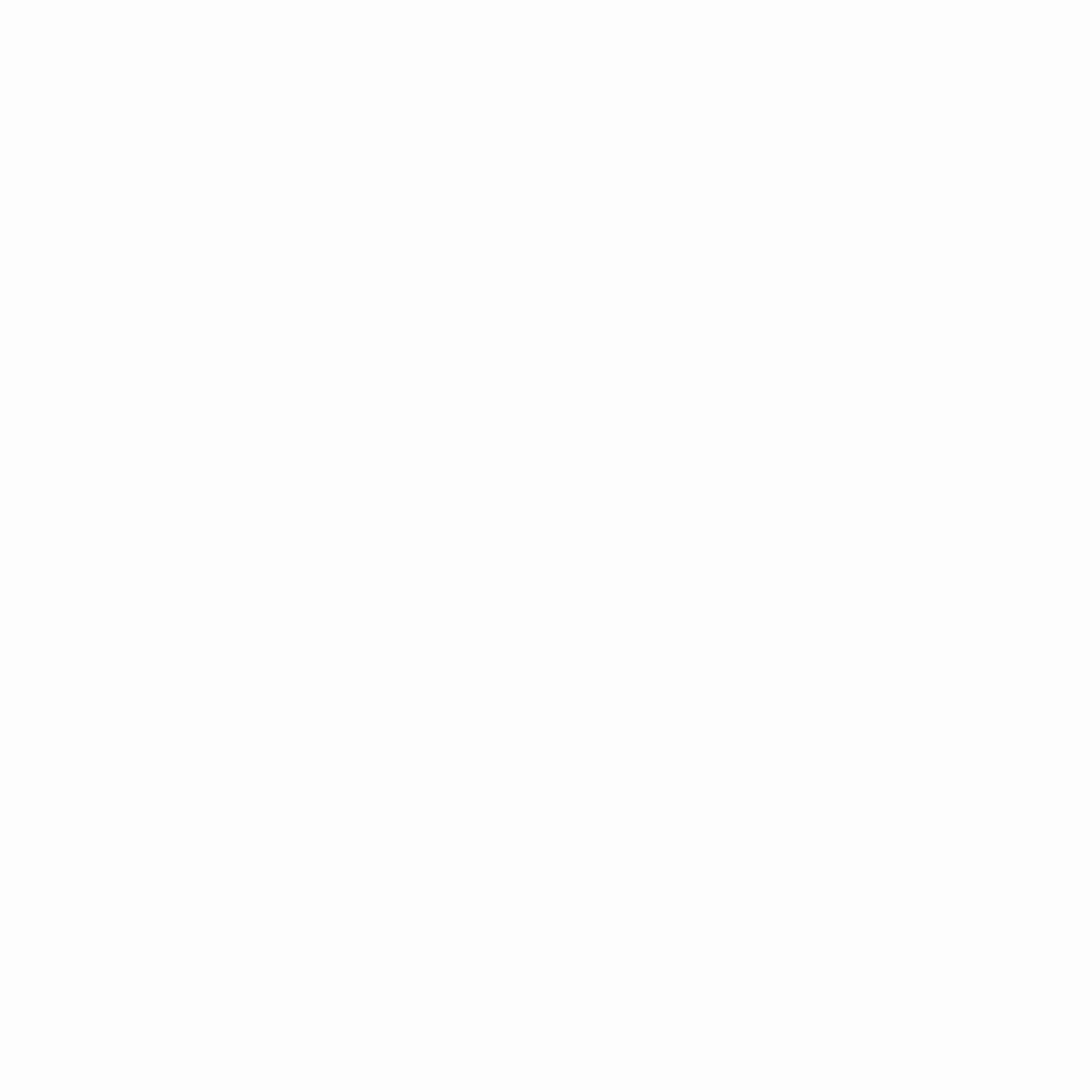Share This Article
Der Erdüberlastungstag bezeichnet den Tag, an dem die Menschen alle natürlichen Ressourcen der Erde für das jeweilige Kalenderjahr rechnerisch aufgebraucht haben. Für den Rest des Jahres werden dann mehr natürliche Ressourcen, wie Waldflächen, Acker- und Weideland oder Fischgründe beansprucht, als zur Verfügung stehen. Außerdem werden selbstredend mehr Treibhausgase ausgestoßen, als Wälder und Ozeane aufnehmen können. Wenig überraschend, dafür umso dramatischer, rückt dieser Tag im Kalender immer weiter nach vorne. Lag der Erdüberlastungstag Anfang der 1970er Jahre noch Ende Dezember, so fällt er inzwischen bereits in den Juli. Noch katastrophaler wird es, wenn man sich die deutsche Bilanz anschaut. Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, wäre der Erdüberlastungstag dieses Jahr bereits Anfang Mai gewesen.
Das grundlegende Problem dürfte mittlerweile klar sein: Während die natürlichen Ressourcen begrenzt und teilweise schon so überlastet sind, dass ihre „Aufnahmekapazität“ abnimmt, ist diese Gesellschaftsordnung endlosem Wirtschaftswachstum verpflichtet. Sofern im politischen Mainstream noch Lösungen größeren Stils für dieses Probleme angeboten werden, verharren diese einfältig im Korsett der Wachstumslogik. Man fantasiert einen technischen Fortschritt herbei, der eine Entkopplung von Wachstum und Naturzerstörung bringen soll. Doch spätestens in Anbetracht der Kippelemente im Erdsystem entpuppen sich Ökomodernismus und Technikoptimismus als Augenwischerei. Die Technik, die uns erretten soll, muss erst noch erfunden werden.
Statt an der Realitätsflucht mitzuwirken, muss man nüchtern festhalten, dass die notwendige absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch nur auf dem Weg einer drastischen Gesamtreduktion des Material- und Energiedurchsatzes zu erreichen ist. Dieses Argument steht im Mittelpunkt der mittlerweile international geführten Debatte über Degrowth bzw. Postwachstum. Wer ernstes Interesse an einer materialistisch fundierten Lösung für die globalen Umweltprobleme hat, kommt an Kernpunkten dieser Argumentation nicht mehr vorbei.
Problematisch an der Degrowth Debatte bleibt, dass Wachstum nicht bloß eine Idee ist, die man durch ein Umdenken aus der Welt schaffen könnte. Hinter dem Wachstumszwang steckt die Kapitalakkumulation samt der auf ihnen fußenden gesellschaftlichen Strukturen. Der Zwang zur rastlose Selbstverwertung des Werts macht ein kapitalistisches Degrowth-Programm zu einem Widerspruch in sich. Schlimmer noch. Wer die dieser Gesellschaft inhärente Klassenspaltung in seinen Ideen für eine Wachstumsrückname nicht mitdenkt, kann politisch schnell Schaden anrichten. Viele Lohnabhängige kommen schon jetzt nicht mehr über die Runden, nicht zuletzt wegen hoher Energie-, Lebensmittel- und Mietpreise. Wer diese Sorgen nicht ernst nimmt, kann ungewollt dazu beitragen, Teile der Arbeiter:innenklasse in die Fänge regressiver Kräfte zu treiben.
In Anbetracht der ökologischen Krise ist es unverständlich, wenn Gewerkschaften und Linke einfach so tun, als wenn nichts wäre und ihre traditionelle Sozialpolitik fortsetzen. Stattdessen müsste es darum gehen, eine ökosozialistische Perspektive zu entwickeln, die für eine (selbst)bewusste menschliche Entwicklung unter der Berücksichtigung der Natur steht. Statt für den klassischen Inflationsausgleich und ein höheres Konsumniveau zu kämpfen, müsste es darum gehen, neue Horizonte zu entdecken. Ein anderes Arbeiten, ein anderes Wohnen, neue Formen von Mobilität, Freizeit und Erholung. Die (Klassen)kämpfe die wir jetzt bräuchten könnten eine gesellschaftliche Infrastruktur in den Blick nehmen, die vor allem auf Sorge, Pflege, Bildung und Gesundheit setzt und dabei immer die natürlichen Ressourcen und die Formen der Energieversorgung mitdenkt. Das Ziel wäre eine sozialökologische Planung jenseits vom bürgerlichen Eigentum und seinem Profit- und Akkumulationszwang mit viel freier Zeit für Freude und Genuss. Statt mehr Konsum, ein besseres Leben, befreit aus dem Hamsterrad der Kapitalverwertung. Eine Erdüberlastung dürfte es dann nicht mehr geben.