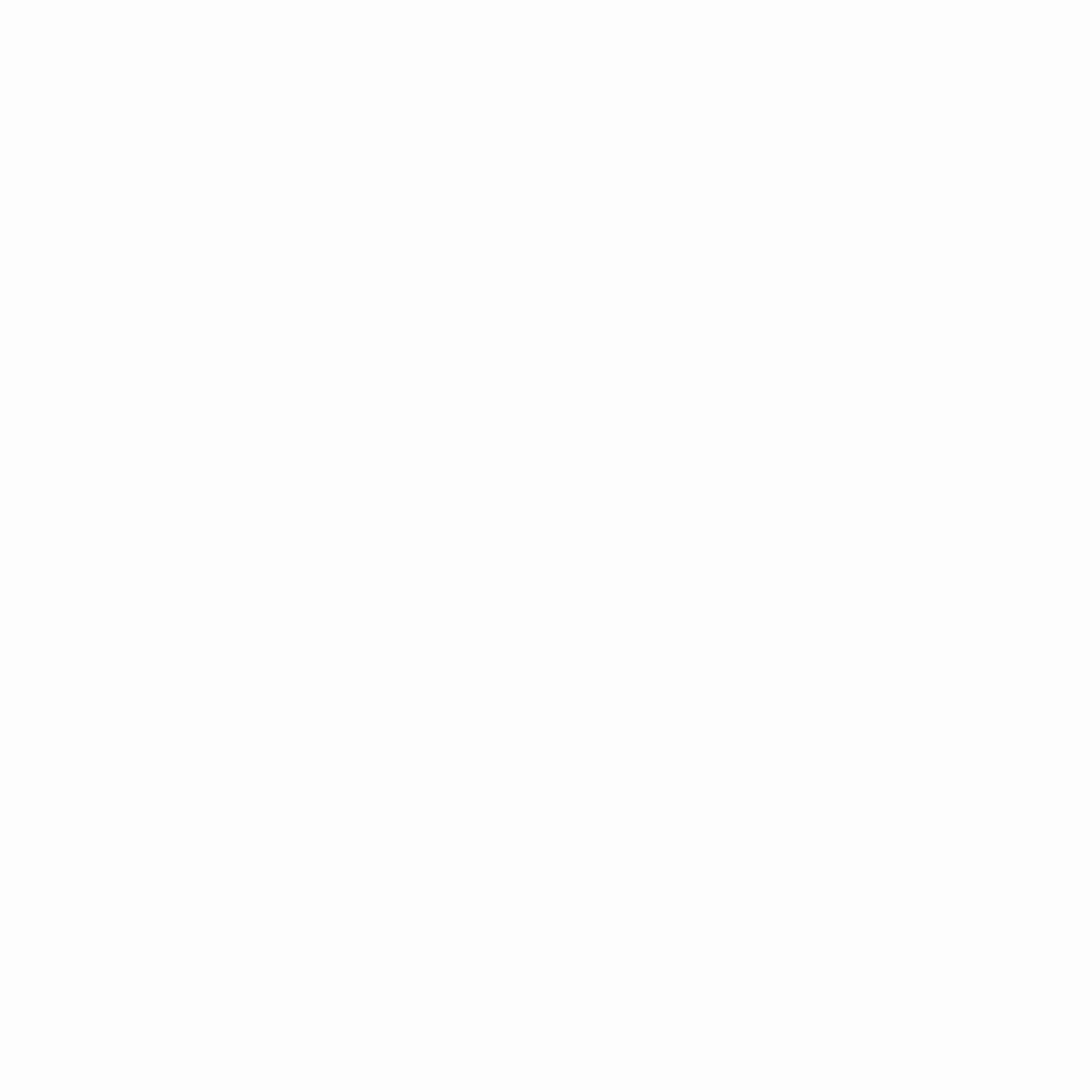Share This Article
Anfang Dezember letzten Jahres führte die Blitzoffensive der islamistischen Miliz Haiʾat Tahrir asch-Scham und ihrer Verbündeten innerhalb weniger Tage zum Sturz des seit mehr als fünf Jahrzehnte herrschenden Assad-Regimes, einer Diktatur, die als eine der repressivsten der Welt galt. Der Beginn einer neuen Ära schien eine bessere und demokratischere Zukunft für die Bevölkerung zu verheißen. Allerdings wurden die Hoffnungen auf eine Zeit ohne Gewalt und Blutvergießen rasch enttäuscht. Nach den Massakern an Alawit:innen im März dieses Jahres durch mit der neuen Regierung verbündete Kräfte haben die Zusammenstöße zwischen Drus:innen, Beduin:innen und offiziellen Truppen, die seit Mitte Juli in südsyrischen Suweida über 1.400 Tote gefordert haben, die ungelösten Konflikte und die tiefe Zerrissenheit des Landes erneut deutlich werden lassen.
Während internationale und regionale Mächte die Konflikte in Syrien instrumentalisieren und ihre eigenen Machtinteressen verfolgen, besteht die Gefahr, dass Stimmen für Solidarität und einen echten demokratischen Wandel im aktuellen Klima der Polarisierung und Repression systematisch marginalisiert werden. Was sind die Ursachen dieser Gewalt? Was sagen uns die Entwicklungen der letzten Monate über die neue Macht? Und welche Zukunft hat Syrien vor dem Hintergrund dieser extremen Spannungen? In einem Interview, das ursprünglich Ende Juli in der libanesischen Tageszeitung L’Orient-Le Jour erschien, spricht Yassin al-Haj Saleh über das Drama einer Gesellschaft, die „in Ermangelung eines echten politischen Lebens und politischer Parteien in paranoide Gemeinschaften zerfallen ist”. Syriens Zukunft bleibt ungewiss – dennoch bewahrt Yassin al-Haj Saleh die Zuversicht auf einen inklusiven Neuanfang, der das Land von Gewalt und Ausgrenzung befreien könnte.
Yassin al-Haj Saleh ist ein syrischer Schriftsteller, Intellektueller und prominenter Dissident, der wegen seiner Opposition zum Assad-Regime 16 Jahre in syrischen Gefängnissen verbrachte und seit 2013 im Exil lebt. Nach seiner Freilassung engagierte er sich als Autor und politischer Essayist. In seinen Büchern setzt er sich kritisch mit Machtstrukturen, Exil und Repression in Syrien auseinander. Auf Deutsch erschien von ihm zuletzt “Darstellung des Schrecklichen. Versuch über das zerstörte Syrien” [1].
Wie sehen Sie die neue Welle der Gewalt, die seit vergangenem Sonntag [2] über den Süden Syriens hereinbricht?
Das ist ein strukturelles Problem. Syrien ist eine sehr vielfältige Gesellschaft, aber die politische Macht hat diese Vielfalt nie widergespiegelt. Historisch gesehen hatten wir ein System, das von einer Einheitspartei dominiert wurde, die zu einem familiären und konfessionellen Regime geworden ist. Heute kontrolliert eine andere Gemeinschaft, die Sunnit:innen, die Macht, aber der Staat repräsentiert weiterhin nicht das gesamte Volk. Man kann das Land nicht stabilisieren, wenn dieses Ungleichgewicht bestehen bleibt.
Solange der Staat sein Monopol aufrechterhält, ohne inklusiv zu sein, werden die Spannungen anhalten. Genau diese Struktur muss geändert werden, um nicht wieder in das gleiche Muster wie unter Assad zu verfallen. Die Gewaltausbrüche an der Küste im März und die aktuellen Übergriffe sind Symptome dafür. Sie bieten auch anderen Mächten wie Israel einen Vorwand, unter dem Deckmantel des Schutzes bestimmter Gemeinschaften zu intervenieren. Aber als Syrer:innen müssen wir zuerst vor unserer eigenen Haustür kehren. Ich mache daher die derzeitige Regierung für diese anhaltende Instabilität verantwortlich.
Ist dieser Wille, ein exklusives Monopol durchzusetzen, auf praktische (um die sunnitische Basis nicht zu entfremden …), ideologische oder religiöse Überlegungen zurückzuführen?
Das Hauptproblem der neuen Verantwortlichen des Landes ist ihr vorherrschender Drang, die Macht in ihren Händen zu konzentrieren. Das ist eine politische Entscheidung, nicht nur eine Frage des religiösen Glaubens. Der Präsident trägt einen Teil der Verantwortung: Entweder kann er nicht handeln, und dann braucht es jemand anderen, oder er weigert sich zu handeln, was noch schlimmer ist. Es ist an der Zeit, diese Zentralisierung in den Händen einer einzigen Gruppe zu beenden.
Wir haben für eine Demokratie gekämpft, die alle Teile der Gesellschaft einbezieht, und dieses Prinzip der Inklusivität steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. Wir haben nicht gegen ein exklusives Regime gekämpft, um dann ein anderes in anderer Form zu akzeptieren. Die Sunnit:innen sind zahlenmäßig in der Mehrheit, aber politisch bedeutet das nichts: Sie sind zu vielfältig und zu gespalten, um einen homogenen Block zu bilden. Und selbst wenn sie sich zusammenschließen würden, würde dies niemals den Ausschluss der Alawit:innen, Drus:innen, Kurd:innen, Christ:innen und anderer Minderheiten rechtfertigen, die ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. In einer so pluralistischen Gesellschaft wie Syrien kann Ausgrenzung einfach nicht funktionieren. Das System muss diese Vielfalt widerspiegeln.
Es ist das zweite Mal, dass Regierungstruppen in Verbrechen gegen Zivilist:innen verwickelt sind, obwohl sie eigentlich für die Wiederherstellung der Ordnung zuständig sind. Welche Folgen wird dies für die syrische Gesellschaft haben?
Die neue Regierung hat es nicht geschafft, die Bevölkerung zu einen: Sie hat ihre Unterstützung nicht verbreitern können und sogar moderate oder kritische Stimmen verloren, die ihr zuvor wohlgesonnen waren. Viele Syrer:innen, die enttäuscht oder wütend sind, halten das, was insbesondere in der Region Latakia geschehen ist, für inakzeptabel. Selbst wenn es sich um einen Fehler oder einen Moment der Panik handelte, bleibt dies in den Augen vieler Bürger:innen unverzeihlich. Über die vernichtende Gewalt hinaus handelt es sich um demütigende Handlungen, die sich gegen Gemeinschaften richten, weil sie sind, was sie sind, und nicht wegen etwas, das sie getan haben. Ganze Familien wurden massakriert. Das ist kein Zufall: Man begeht nicht zweimal innerhalb von vier Monaten dieselben Gräueltaten, ohne dass dies systemisch geschieht.
Wie lässt sich erklären, dass der Staat diese Verbrechen in seinen eigenen Reihen nicht verhindern kann?
Die neue Regierung befindet sich in der schwächsten Position seit ihrer Machtübernahme. Entweder hat sie keine Kontrolle über die bewaffneten Gruppen, was alarmierend ist, oder sie hat Kontrolle über sie, was noch gravierender ist. Sie hat an Glaubwürdigkeit und Unterstützung verloren, und ihre Popularität ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Die politische Niederlage – verschärft durch den Druck von außen durch die Vereinigten Staaten, die Türkei, die arabischen Länder und die Verbrechen der eigenen Streitkräfte sowie durch die Aggression Israels, das täglich Völkermord in Gaza begeht und in Syrien interveniert, um die Spaltungen zu vertiefen und das Land weiter zu schwächen – wurde schlecht gehandhabt. Darüber hinaus hat die Kommission, die mit der Untersuchung der Massaker an der Küste beauftragt ist, ihre Ergebnisse trotz Überschreitung der Fristen noch immer nicht veröffentlicht.[3] Das Schweigen und das Ausbleiben von Gerechtigkeit schüren die Wut. Indem das Regime Untersuchungen ohne konkrete Ergebnisse verspricht, untergräbt es nur seinen eigenen Legitimitätsverlust.
In Ihrem letzten Buch [4] formulieren Sie das Konzept der „Viktimisierung“ der Sunnit:innen, ein Gefühl, das aus ihrer Diskriminierung und Unterdrückung unter Assad resultiert. Wie hat sich dies insbesondere während der Massaker im März manifestiert?
Das Gefühl der Viktimisierung ist bei vielen Sunnit:innen tief verwurzelt. Denn in Syrien gab es diese Diskriminierung tatsächlich: Die Chemiewaffenangriffe und die Fassbomben richteten sich vor allem gegen diese Gemeinschaft. Diese Ressentiments nähren auch den sunnitischen Islamismus, sei es in Form von Dschihadismus oder einer diffuseren Radikalisierung. Denn die Opferrolle wird nicht nur gelebt, sondern auch erzählt, strukturiert und von Ideolog:innen in mächtige Identitätserzählungen verwandelt. Dieser Diskurs hat sich nach der Revolution verstärkt und verleiht der erlittenen Gewalt eine nahezu ewige Bedeutung, als ob die Zugehörigkeit zum sunnitischen Islam unweigerlich mit Verfolgung verbunden sei. Die Sunnit:innen haben somit sowohl einen Opferdiskurs („Wir wurden massakriert, diskriminiert, gefoltert“) als auch einen Diskurs der Vorherrschaft („Wir sind die wahren Muslime, die Träger der wahren Botschaft“) entwickelt.
Die Überlegenheitsrhetorik stützt sich sowohl auf eine religiöse Vision als auch auf eine Verherrlichung des umayyadischen Erbes, was in den letzten Monaten neu hinzugekommen ist. Einige regierungsfreundliche Intellektuelle, Journalist:innen und konservative sunnitische Dichter haben begonnen, eine „umayyadische Identität” zu propagieren, um nicht offen von einer sunnitischen Identität sprechen zu müssen, auch wenn diese klar impliziert ist. Indem sie die Umayyaden verherrlichen, stellen sie ein imperiales Erbe in den Vordergrund, das Schiit:innen und Alawit:innen implizit ausschließt (da die Umayyaden historisch gesehen Ali [5] besiegt haben, eine für diese Gemeinschaften heilige Figur). Diese ideologische Konstruktion gibt vor, eine historische syrische Identität zu begründen, beruht jedoch auf einem Widerspruch: Die Umayyaden waren nicht besonders fromm, manchmal wurden sie sogar als weltlich angesehen, im Gegensatz zu den Personen, gegen die sie kämpften. Aber Ideologien kümmern sich schließlich nicht um Ungereimtheiten. Dieser Diskurs versucht lediglich, eine Macht zu legitimieren, die nach symbolischen Wurzeln sucht. Dennoch nähren sich diese beiden Narrative – das der Opferrolle und das der Vorherrschaft – gegenseitig und vermitteln letztlich ein Gefühl der Berechtigung zur Herrschaft.
Wie werden diese Erzählungen aufrechterhalten?
Die jüngsten Massaker sind auch auf einen Konflikt der Erinnerungen zurückzuführen. Im März beispielsweise stützten sich sunnitische oder islamistische Gruppen, die alawitische Gemeinschaften angriffen, manchmal auf weit zurückliegende Erinnerungen. Die Alawit:innen ihrerseits haben ihre eigenen Erinnerungen an Diskriminierung und Unterdrückung vor dem Assad-Regime. Heute sind diese Opfererzählungen wie vergrabene Minen: Sie prägen Identitäten, spalten und rechtfertigen Gewalt. Deshalb versuchen nur wenige Menschen, Brücken zwischen diesen Erinnerungen zu schlagen, um anderen zu helfen, die mit diesen unterschiedlichen Erinnerungen verbundenen Muster zu überwinden. Und leider verschließt sich jede Gemeinschaft in der Leugnung des Leids der anderen. Das ist das wahre Drama Syriens: Niemand kann mehr zwischen den Leiden vermitteln.
Haben diese verschiedenen Konflikte ausschließlich religiöse Ursachen?
Nein, denn die Spaltung der Gesellschaft in Syrien hat auch eine klassenbezogene Dimension, die sich in den Massakern an der Küste gezeigt hat. Oft wird angenommen, dass das Sektierertum in Syrien auf irrationalem Hass zwischen den Konfessionen beruht. In Wirklichkeit hat es seine Wurzeln in einem System der sozialen Ausgrenzung: Es ist eine Frage der Klasse, der Klientelpolitik und des Zugangs zu Chancen. Was die Menschen empört, ist nicht nur die materielle Armut, sondern das Gefühl der Vernachlässigung, der Unsichtbarkeit und der Verachtung. Wasta (Beziehungen), auch „Vitamin W” genannt, wird als das angesehen, was Türen öffnet, nicht zu Privilegien, sondern zu Grundrechten. Ohne sie fühlt man sich machtlos.
Ein Prozess, der Ihrer Meinung nach vor mehreren Jahrzehnten begann …
Ja, genau. Ab den 1960er Jahren erhielten Minderheiten, insbesondere die Alawit:innen, dank einer Umverteilung der Chancen Zugang zum Staatsapparat und zur Armee. Aber die große Mehrheit der alawitischen Gemeinschaft blieb arm und lebte in Dörfern und in den Bergen. Bis Anfang der 2000er Jahre wurden sie abwertend als „Rifiyin” („Landbewohner:innen”, „Provinzler:innen“) bezeichnet. Mit der von Baschar al-Assad durchgeführten wirtschaftlichen Liberalisierung, die die Armut der sunnitischen Volksschichten verschärfte, begann sich die Lage zu ändern. Es waren nun sie, die man begann als „Rifiyin” zu bezeichnen, da ihre politischen Positionen als archaisch oder ungebildet angesehen wurden. Es handelt sich um eine historische Wiederholung, jedoch in umgekehrter Form. Dieses Phänomen betrifft jedoch nicht nur die Sunnit:innen. Jede Gemeinschaft in Syrien, ob Alawit:innen, Kurd:innen, Christ:innen oder Sunnit:innen, pflegt ihre eigene Legende der Opferrolle und Überlegenheit. Das Assad-Regime hat dieses Misstrauen weitgehend geschürt. In Ermangelung eines echten politischen Lebens und von Parteien ist die syrische Gesellschaft in paranoide Gemeinschaften zerfallen. Paranoia bedeutet jedoch, zu glauben, dass man sowohl Opfer als auch anderen überlegen ist.
Kann sich die Gewalt weiter ausbreiten?
Ich hoffe nicht. Ich stütze mich dabei auf die Tatsache, dass diejenigen, die sie ausgelöst haben, nun wissen, dass sie sich keinen dritten Fehler leisten können. Das Fiasko ist offensichtlich, und jede:r in Syrien ist sich dessen bewusst geworden. Zwar sind die Zutaten für Gewalt und Zusammenbruch nach wie vor vorhanden, denn das Land ruht auf drei großen Schwachstellen. Erstens das Erbe Assads: 54 Jahre brutale und zentralisierte Macht, die nach außen hin starr erscheint, aber von innen heraus zerfressen ist. Zweitens das Fehlen jeglicher rationaler Gruppe in der syrischen Gesellschaft, die das Land in eine bessere Zukunft führen könnte: keine starken politischen Kräfte, keine gemeinsame Vision, nur gemeinschaftliche Reflexe, zersplitterte Interessen. Und schließlich sind die derzeitigen Machthaber mit zahlreichen Meutereien konfrontiert. Einige sind extremistisch, andere haben Rache im Sinn.
Noch besorgniserregender ist das allgemeine Klima: Es gibt keine rationale Debatte und keine klare Analyse mehr. Alles ist sektiererisch, polarisiert und hasserfüllt geworden. Anstatt für ein inklusives politisches System einzutreten, ziehen sich viele auf Brandreden zurück. Die sozialen Netzwerke sind zum Schauplatz eines virtuellen Bürgerkriegs geworden, der von Irrationalität und der Ablehnung des Anderen angeheizt wird. Selbst die gemäßigten Stimmen, die es hier und da gibt, werden von der Logik der Gewalt und des Überlebens erstickt.
Um sich wieder aufzubauen, braucht die syrische Gesellschaft Gerechtigkeit, Chancengleichheit, gemeinsame Sicherheit, gleichen Zugang zu Ressourcen und Rechten. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, es wird Extremist:innen geben, die dagegen sind, aber die Mehrheit wird eine integrative Lösung unterstützen, vor allem, wenn sie von der Regierung kommt. Nur wenige Syrer:innen wollen glauben, dass alles verloren ist. Aber es muss jetzt gehandelt werden: eine echte nationale Konferenz mit Vertreter:innen aller Gemeinschaften. Alles, was in den letzten Monaten getan wurde, auch vor den Massakern und der Verfassungserklärung, war nur eine Strategie, um die Macht zu konzentrieren. Das funktioniert nicht. Hafiz al-Assad hat es versucht, mit Massakern und Gefängnissen wie Tadmor und Sednaya. Das Ergebnis ist das derzeitige Chaos. Zu glauben, dass man es besser machen kann, indem man dieselben Fehler wiederholt, ist illusorisch.
Die Politik muss die Grundlagen des Denkens beleuchten. Und wenn man aus einem so tragischen Land wie Syrien kommt, muss man diese Grundlagen noch weiter ausbauen, um Entscheidungen zu vermeiden, die das Land schwächen. Angesichts einer Katastrophe wie der, die Syrien erlebt hat, ist es entscheidend, gut zu überlegen, bevor man handelt. Gipfeltreffen reichen nicht aus, vor allem nicht mit atypischen Gruppen. Um voranzukommen, braucht es mehr Weitblick.
Wie sehen Sie die Zukunft Syriens?
Ich neige dazu, apokalyptische Darstellungen abzulehnen. Nicht weil sie zu pessimistisch sind, sondern weil sie falsch klingen: Es handelt sich nicht um Interpretationen der Realität, sondern um Projektionen, versteckte Wünsche, unterdrückte Wut, zu Diagnosen recycelter Hass. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich nicht wesentlich von Diskursen über Opferrolle oder Vorherrschaft. Es ist derselbe narrative Antrieb.
Aber um ehrlich zu sein, habe ich Angst. Angst, dass diese Tragödie schlimmer sein könnte als die anderen, und wir haben so viele erlebt, wir wurden mit Tragödien überhäuft, vor allem in den letzten 14 Jahren. Ich habe Angst, dass all das noch vor uns liegt, anstatt hinter uns zu liegen, wegen der Selbstsucht, wegen des Wahnsinns so vieler Menschen. Wenn ich versuche, rational zu denken, habe ich das Gefühl, dass wir mit offenen Augen auf den Abgrund zusteuern. So kann es nicht weitergehen. Niemand darf sich einreden, dass ihre:seine Religion anders ist, dass ihre:seine Gruppe anders ist und dass ihr:m dies Rechte oder Befugnisse zum Handeln einräumt. Ich befürchte daher, dass die Zukunft düster sein wird, wenn nicht schon jetzt eine große Wende eingeleitet wird.
Referenzen
Ursprünglich veröffentlicht auf L’Orient-Le Jour. Für emanzipation aus dem Französischen übersetzt von Harald Etzbach.
[1] Berlin (Matthes & Seitz) 2023 (übersetzt von Günther Orth).
[2] 13. Juli.
[3] Am 22. Juli gab die von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission auf einer Pressekonferenz einen Überblick über die Ergebnisse des Abschlussberichts. Allerdings bleibt der Bericht in seiner Gesamtheit weiterhin unter Verschluss.
[4] Sur la liberté : la maison, la prison, l’exil… et le monde, Paris (Éditions L’Arachnéen) 2025 (übersetzt von Marianne Babut und Cyril Béghin). Der erste der in diesem Buch versammelten Texte liegt auch in einer deutschen Übersetzung vor: Freiheit: Heimat, Gefängnis, Exil und die Welt, Berlin (Matthes & Seitz) 2020 (übersetzt von Günther Orth).
[5] Ali ibn Abi Talib, der Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Schiitische Muslim:innen sehen ihn als den legitimen Nachfolger des Propheten.