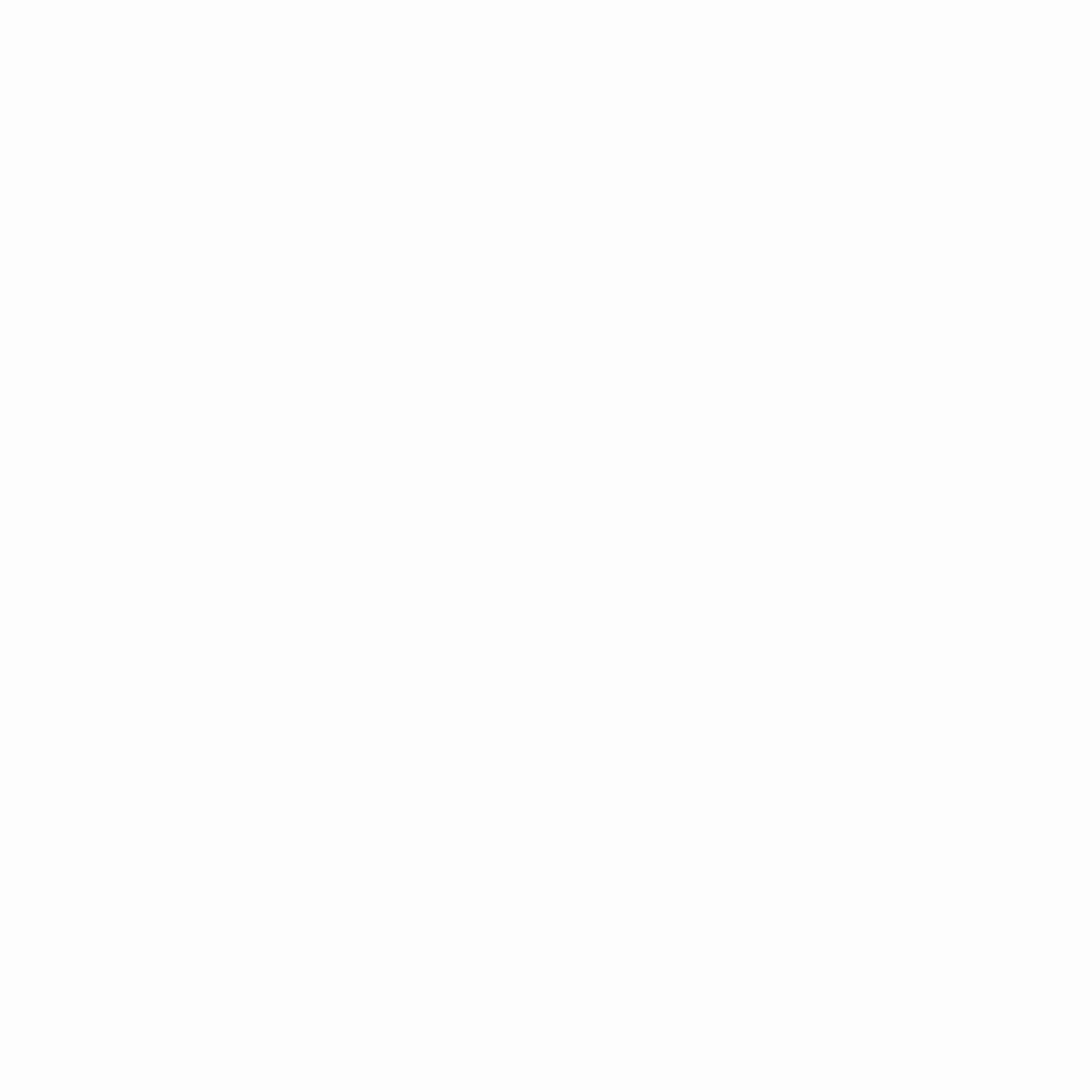Share This Article
Die kapitalistische Produktionsweise ist eine globale Gesamtheit. Nahezu alle großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen sind in ihrem globalen Gesamtzusammenhang zu verstehen und anzugehen. Zugleich weisen sie eine starke kontinentale beziehungsweise europäische Dimension auf. Die europäischen Gesellschaften und Ökonomien sind wesentlich stärker untereinander verflochten als zu anderen Räumen der Welt. Das lässt sich an der Mobilität der Menschen, dem Warenverkehr, den ineinandergreifenden Produktions- und Innovationssystemen, den Kapitalverflechtungen und schlicht an den persönlichen Beziehungen vieler Menschen ablesen. Ähnliche Verflechtungen sind auch in anderen Kontinenten oder Makroregionen zu beobachten.
Zugleich ist die europäische Integration seit Mitte der 1950er Jahre eine zentrale Ebene der Kapitalherrschaft. Bereits die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 stellte die Freiheit des Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehrs vor den Prozess einer gesellschaftlichen und politischen Vereinigung (Zeller 2006b). Es gab zu keiner Zeit eine breite demokratische Diskussion darüber, wie das gemeinsame Europa politisch und gesellschaftlich verfasst sein soll. Es gab auch nie ernsthafte Versuche, eine europäische verfassungsgebende Versammlung einzuberufen.
Die EU hatte von Anfang an neoliberale und autoritäre Züge, die sich seit den 1990er Jahren zunehmend stärker herausbildeten und wirkmächtiger wurden. Der 1997 initiierte und seither vertiefte Stabilitäts- und Wachstumspakt war eine entscheidende Etappe in diesem Prozess. Das vordringliche Ziel der EU ist die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Konzerne in den großen Volkswirtschaften der EU. Die europäische Integration wurde zu einem zentralen Hebel, um die Kräfteverhältnisse zugunsten der Kapitalinteressen zu verändern. Die Liberalisierungen und Deregulierungen halfen dem Finanzkapital sich sozusagen auf die Kommandobrücke der Wertschöpfungsprozesse, also der Akkumulation des Kapitals, zu hieven (Sablowski 2024; Heine und Sablowski 2015).
Nun stehen wir vor der Herausforderung, dass die neoliberale Politik der EU und der nationalen Regierungen, die europäische Integration selber massiv unterminiert. Auf das gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Desaster reagieren reaktionäre Kräfte jeglicher Art – Sozialkonservative, Nationalkonservative und Faschist:innen – mit einer plumpen Propaganda für den Erhalt der nationalen Souveränität. Einige stellen die EU rhetorisch propagandistisch und manchmal auch ernsthaft praktisch in Frage. In West- und Osteuropa erzielen Reaktionäre und offene Faschist:innen große Wahlerfolge und haben die Aussicht, Regierungen zu übernehmen. Die neoliberalen Versprechungen auf ein prosperierendes und dynamisches Europa glaubt kaum noch jemand. Die Gefahr eines reaktionären bis faschistischen Vormarschs ist real.
In dieser Situation ist es besonders tragisch, dass die klassische Linke, sei sie modernistisch, reformorientiert, antikapitalistisch oder revolutionär keine Vorstellungen einer gemeinsamen europäischen Gesellschaft hat. Schlimmer, in Europa tobt seit drei Jahren der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind weit entfernt von einer Perspektive auf ein ökologisch nachhaltiges und solidarisches Europa der Arbeitenden und Lohnabhängigen. Eine konsistente und glaubwürdige strategische Hypothese einer ökosozialistischen Umgestaltung der europäischen Gesellschaften gibt es nicht.
Der Austritt einzelner Länder aus der EU bietet keine solidarische Perspektive. Die in den Institutionen der EU eingeschriebene neoliberale Logik lässt sich nur gemeinsam auf europäischer Ebene bekämpfen. Zugleich kann aber die EU nicht der Orientierungsrahmen für eine sozialökologischen Transformation oder gar einen ökosozialistischen Bruch und Aufbruch sein. Die Gesellschaften in Europa sind größer und vielfältiger als die EU. Ein solidarisches und ökologisches europäisches Gesellschaftsprojekt muss also die Fesseln der EU sprengen und über die EU hinausgehen. Wie können und sollen ökosozialistische Kräfte mit dieser komplizierten und widersprüchlichen Situation umgehen? Das ist eine Frage, mit der sich mehrere Beiträge in dieser Ausgabe von emanzipation auseinandersetzen.
Vor mehr als zwanzig Jahren hatten wir große Hoffnungen in die Bewegung der europäischen Sozialforen, die diese Herausforderung zumindest ansatzweise annahmen. Ich erinnere mich an das erste Europäische Sozialforum Anfang November 2002 in Florenz, das eine enorme Dynamik ausstrahlte und Hoffnung vermittelte. An diesem Forum wurde die große globale Demonstration am 15. Februar 2003 gegen den drohenden Angriff der USA gegen den Irak beschlossen. Zu jener Zeit gab es eine Föderation antikapitalistischer Parteien in Europa mit der Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) in Frankreich, dem Bloco de Esquerda in Portugal, der Socialist Workers Party (SWP) in Großbritannien, gewichtigen Kräften innerhalb des Partito de Rifondazione Comunista in Italien und etlichen anderen Organisationen in weiteren Ländern. Die globalisierungskritische Bewegung bot Impulse, um die Eigentumsfrage europaweit aufzuwerfen (Zeller 2006a).
Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab den Jahren 2007/08 und der europäischen Krise, die schließlich Griechenland und weitere Regionen Europas ins Elend stürzte, war die gesamte Linke – reformorientierte und revolutionäre – weit davon entfernt, eine gemeinsame europäische Orientierung vorzuschlagen. Während der Covid-Pandemie haben wir erneut versagt. Es gab keine relevante linke Initiative, um der Pandemie solidarisch auf kontinentaler Ebene zu begegnen und die Dynamik der Ausbreitung des Virus großräumig zu verlangsamen. Verantwortungsbewusste Wissenschaftler:innen und Mediziner:innen argumentierten immerhin für international koordinierte Maßnahmen (Iftekhar, et al. 2021; Priesemann, et al. 2021; Zeller 2020). Die ZeroCovid-Initiativen in Irland, Großbritannien und den deutschsprachigen Ländern sowie vergleichbare Widerstandskollektive in anderen Ländern zielten richtigerweise auf eine konsequente Pandemiebekämpfung „von unten“ und „für unten“, handelten aber weitgehend national oder regional vereinzelt.
Wir stehen nun mit dem russischen Krieg gegen die ukrainische Bevölkerung, der zögerlichen und inkonsequenten Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Regierungen, einer drohenden Niederlage der Ukraine und damit einhergehend einer Massenflucht und Massendemoralisierung sowie einem weiteren Vormarsch reaktionärer Kräfte vor einer dramatischen Situation. Nicht weniger tragisch ist, dass nahezu alle europäischen Regierungen sich auf die Seite des Staates Israel und seinem genozidalen Krieg gegen die palästinensische Gesellschaft stellen. Millionen wenn nicht Milliarden von Menschen im sogenannten „globalen Süden“ betrachten nicht nur die europäischen Staaten, sondern auch die europäischen Gesellschaften, verständlicherweise als mitverantwortlich für die andauernde Nakba – Katastrophe – am palästinensischen Volk. Da tun sich tiefe Schlünde auf, die ein gegenseitiges Verständnis „von unten“ erschweren. In beiden Kriegen zeigten sich beträchtliche Teile der Linken – von Land zu Land unterschiedlich – nicht in der Lage eindeutig Stellung zu nehmen für die Angegriffenen, Diskriminierten, Vertriebenen und unter Besatzung Lebenden.
Genau in dieser Situation haben wir Ökosozialist:innen kaum europäische Perspektiven anzubieten. Wir stehen in der Pflicht, konkrete Vorschläge für eine Übergangsperspektive, ein europäisches ökosozialistisches Programm, zu entwerfen und vor allem auch zu überlegen, wie sich die Kräfteverhältnisse lokal, regional, national, kontinental und global verändern lassen. Das ist selbstverständlich verbunden mit der Herausforderung auch Organisationen aufzubauen, die für eine derartige Perspektive einstehen. Wenn ich hier für eine europäische Perspektive plädiere, ist das selbstverständlich keine Absage an eine Orientierung auf universelle globale Solidarität mit allen Kräften, die gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Imperialismus kämpfen, und zwar jenseits aller geopolitischen Erwägungen. Ganz im Gegenteil, eine solidarische kontinentale Perspektive wäre ein enormer Impuls und eine Ermutigung für ökosozialistische und emanzipatorische Bewegungen anderswo auf der Welt, ganz besonders in Nordamerika und möglicherweise auch in China und Indien, die allerdings ihre eigene Orientierung finden müssen.
Diese strategische Lücke ist dringend mit einer revolutionären ökosozialistischen Perspektive zu schließen. Dazu wollen wir von emanzipation mit dem Schwerpunktthema dieses Heftes einen Beitrag leisten. Voraussetzung für eine programmatische und strategische Klärung ist allerdings eine Analyse der Situation. Die Aufgabe ist umfassend. Wir können bloß einige Impulse setzen. Einerseits ist eine grundlegende Analyse der EU erforderlich. Andererseits würde der ausschließliche Blick auf die EU und ihrer Mitgliedsstaaten die Sicht auf die Gesellschaften an der Peripherie und jenseits des Kontinents verdecken. Eine solidarische und ökologische kontinentale Perspektive schließt selbstverständlich die Ukraine, Belarus, Moldau, die Balkanstaaten und Russland ein. Wir wollen auch ökosozialistischen Aktivist:innen in Osteuropa eine Stimme im deutschen Sprachraum zu verleihen.
Wir gliedern das Heft in drei Teile. Im ersten Teil sprechen wir grundsätzliche programmatische Lücken und strategische Herausforderungen an, die sich durch aktuelle Entwicklungen in Osteuropa noch verschärft haben. Christian Zeller argumentiert, dass ökosozialistische Organisationen dringend eine europäische Perspektive und Praxis entwickeln müssen. Ohne Aufbau einer kontinentalen Gegenmacht bleibt es unmöglich, das verflochtene und zentralisierte fossile Kapital zu entmachten und den gesamten fossilen Komplex zurückzubauen. Im Gespräch erörtert Catherine Samary, warum frühere Versuche europäischer Organisierungsprozesse scheiterten. Sie betont die zentrale Bedeutung einer europäischen Friedensperspektive, die den Ambitionen und dem Schutzbedürfnis der Menschen in Osteuropa Rechnung trägt. Jakub Ort und Josef Patočka loten ausgehend von ihren Erfahrungen in Tschechien Möglichkeiten einer linken Neuformierung aus. Sie argumentieren für eine ökosozialistische Klassenpolitik in Osteuropa jenseits des Bestrebens zum „Westen“ aufzuholen und der Hinwendung zum Nationalismus. Ia Eradze, Luka Nakhutsrishvili und Lela Rekhviashvili zeichnen im Gespräch mit Ashley Smith und Ilya Budraitskis die jüngere Entwicklung in Georgien nach und schildern eindrücklich, warum und wie sich große Teile der Bevölkerung gegen das autoritäre Regime der Partei Georgischer Traum erhoben haben.
Im zweiten Teil publizieren wir Beiträge, die eine transnationale und globale Perspektive einnehmen und unterschiedliche Entwicklungen auf der Welt in einen gemeinsamen Zusammenhang stellen – und zwar aus einer solidarischen Perspektive von unten gegen jedes geopolitische Blockdenken. Ilya Budraitskis analysiert den russischen Imperialismus, der durch Faschisierung des Herrschaftsregimes einen spezifischen Charakter angenommen hat. Budraitskis zeigt, wie wichtig es für eine antifaschistische Strategie ist, dass sich Russland im Krieg gegen die Ukraine nicht durchsetzt. Die ukrainische ökosozialistische Organisation Sotsialnyi Rukh verbindet in ihrer Erklärung den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung mit dem eigenen Widerstand gegen die russische Besatzung. Sie plädiert dafür, dass sich diese Widerstände gegenseitig unterstützen sollten. Adam Hanieh argumentiert, dass sich die Solidaritätsbewegung mit Gaza zu stark auf die Verbrechen einzelner Politiker:innen und Regierungen ausrichte. Sie verlöre damit die Auseinandersetzungen über die Kontrolle über das Öl und den Ölpreis aus den Augen. Hanieh unterstreicht die enorme Bedeutung eines Ausgleichs zwischen den Golfstaaten und Israels für die US-amerikanische Macht im Nahen Osten. Schließlich versuchen Pierre Rousset und Jaime Pastor in ihrem Gespräch einen roten Faden durch die globalen Krisen, Konflikte und Kriege ziehen. Sie argumentieren für einen Internationalismus, der den grundlegenden globalen Veränderungen und dem Aufstieg neuer autoritärer Mächte Rechnung trägt.
Im dritten Teil versammeln wir aktuelle Beiträge über den Widerstand der Ukraine gegen die russische Besatzung, den sozialen Widerstand in der Ukraine gegen die neoliberale Regierung unter Selenskyj und die Nahrungsmittelsicherheit. Wir dokumentieren den bemerkenswerten Appell, den Arbeiter:innen und Aktivist:innen der Zivilgesellschaft am 1. Mai 2024 in der ukrainischen Bergbaustadt Krywyj Rih an Gewerkschaften und linke Organisationen in Europa richteten und darin zur gemeinsamen Klassensolidarität von unten aufriefen. Aus Auslass der internationalen Friedenskonferenz, die die Schweizer Regierung in Absprache mit der ukrainischen Regierung am 15. und 16. Juni in der Nähe von Luzern durchführte, initiierten wir von emanzipation, zusammen mit der Bewegung für den Sozialismus und solidaritéS in der Schweiz, Sotsialnyi Rukh in der Ukraine und der russischen Zeitschrift Posle die internationale Erklärung „Ukraine: Ein Frieden der Bevölkerungen, kein imperialer Frieden“. Wir dokumentieren diese programmatisch in eine ökosozialistische Richtung zielende Erklärung. In seinem Beitrag „Frieden in der Ukraine und ökosozialistische Perspektiven in Europa“ erläutert Christian Zeller diese Erklärung und erklärt, warum wir die Solidarität mit ukrainischem Widerstand mit dem Kampf für einen ökosozialistischen Umbruch in Europa verbinden müssen. Er geht dabei besonders auf das schwierige Spannungsfeld von notwendiger Bewaffnung der Ukraine und grundsätzlicher Orientierung auf eine solidarische und ökologische Friedensperspektive in ganz Europa ein.
Taras Bilous hat sich unmittelbar nach Beginn der russischen Großinvasion zunächst der Territorialverteidigung und dann der ukrainischen Armee angeschlossen. Er schildet im Interview die schwierige gesellschaftliche und politische Situation in der Ukraine und erklärt eindrücklich, warum er als Sozialist sich an der Verteidigung der ukrainischen Gesellschaft gegen die russische Besatzung beteiligt. Die ukrainische Regierung ringt zwar um Unterstützung durch die Regierungen der USA und Europas. Zugleich unterminiert sie mit ihrer neoliberalen, antisozialen und gewerkschaftsfeindlichen Politik die Verteidigungs- und Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung. Sotsialnyj Rukh versucht dem zunehmenden Unbehagen in der ukrainischen Gesellschaft gegen die gefährliche Politik der Führung um Selenskyi eine Stimme zu verleihen. Im Beitrag „Der Weg zum Sieg und die Aufgabe der ukrainischen Linken“ legt sie ihre Argumente offen. Oleksandr Kyslov zeigt in seinem Diskussionsbeitrag, warum die Politik Selenskyjs gefährlich ist. Nur eine Orientierung, die den Reichen die ihnen zustehende Verteidigungslast aufbürdet, eine möglichst solidarische Infrastruktur aufbaut und die strategisch wichtigen Industrien der Kontrolle der Gesellschaft übergibt, ist in der Lage die nötige Resilienz in der ukrainischen Gesellschaft aufzubauen. In der medialen Berichterstattung geht unter wie der Krieg die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung gefährdet und enorme Umweltschäden anrichtet. Valeri Petrov argumentiert, dass das Recht auf Nahrung und die Ernährungssouveränität gerade im Krieg und angesichts umfangreicher Preissteigerungen für Lebensmittel unabdingbare Anliegen sind. Das gilt nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Kriegsgebiete. Natalia Mamonova informiert im Interview über den Zustand der Landwirtschaft im Krieg. Sie erläutert welche Auswirkungen die Bodenreform auf die Zukunft des Landes hat und wie ein sozial und ökologisch gerechter Ansatz für den Wiederaufbau der Landwirtschaft nach dem Krieg aussehen könnte.
Literatur
Heine, Frederic und Sablowski, Thomas (2015): Zerfällt die Europäische Währungsunion? Handels- und Kapitalverflechtungen, Krisenursachen und Entwicklungsperspektiven der Eurozone. Prokla 45 (4 (181)), S. 563-591.
Iftekhar, Emil Nafis, et al. (2021): A look into the future of the COVID-19 pandemic in Europe: an expert consultation. The Lancet Regional Health – Europe 2021/07/30/, S. 100185. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221001629.
Priesemann, Viola, et al. (2021): Calling for pan-European commitment for rapid and sustained reduction in SARS-CoV-2 infections. The Lancet 397 (10269) 18. Dezember 2020, S. 92-93. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32625-8.
Sablowski, Thomas (2024): Der Kapitalismus in der EU seit der Finanzkrise von 2007–2008. Kontinuitäten und Brüche. In: T. Sablowski und P. Wahl (Hrsg.): Europäische Integration in der multiplen Krise. Zukunftsaussichten der Europäischen Union. Hamburg: VSA Verlag. S. 9-21.
Zeller, Christian (2006a): Eigentumsfrage europaweit stellen;VorSchein, Jahrbuch 2006 der Ernst-Bloch-Assoziation. Prinzip Hoffnung als Perspektive? Zur politischen Praxis konkreter Utopie (27/28), Antogo Verlag: Nürnberg, 35-58 S.
Zeller, Christian (2006b): Vom Nein zum Verfassungsvertrag zur gesellschaftlichen Aneignung Europas. In: A. Klein und P. B. Kleiser (Hrsg.): Die EU in neoliberaler Verfassung. Köln: Neuer ISP Verlag. S. 54-73.
Zeller, Christian (2020): Für eine europäische Strategie gegen die Pandemie. Die Freiheitsliebe. 30. Dezember 2020. https://diefreiheitsliebe.de/politik/fuer-eine-europaeische-strategie-gegen-die-pandemie/. Zugriff 30. Dezember 2024