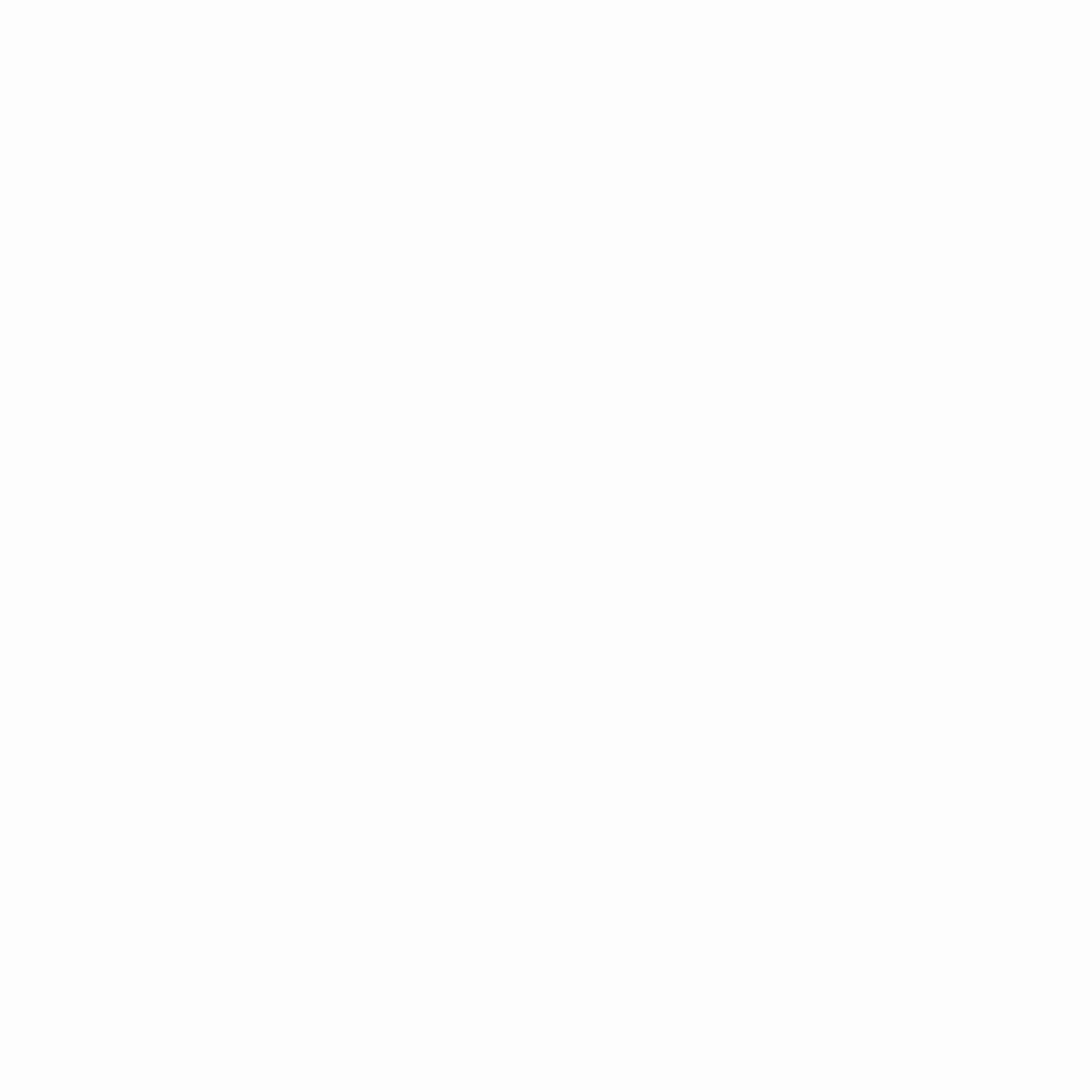Share This Article
Die globale Finanzkrise war zuerst ein sektorales Problem des Finanzmarktes, dann aber zunehmend auch ein nationales – so schien es zunächst. Spekulationsblasen, Bankensterben, Kreditklemmen und aufkommende Währungskrisen deuteten auf eine schwere globale Krise hin, die schwerste nach dem Börsencrash Ende der 1920er Jahre. Ihre Folgen sickerten, so zeigte sich bald, auf die National- und Regionalökonomien durch – alte Ungleichheiten wurden verschärft, es gab Krisengewinner und -verlierer. Dies wurde besonders deutlich in der Eurozone sichtbar. Staaten mit Exportorientierung und Aussenhandelsüberschuss wie die Bundesrepublik Deutschland wurden im Ergebnis von den Turbulenzen der Finanzmarktkrise weniger erfasst als alte Peripherien, für die sich die Kombination von Bankenkrisen, rasch zunehmender Staatsverschuldung und eingeschränkten Zugängen zu Krediten innerhalb weniger Monate zu handfesten nationalen und regionalen Überschuldungskrisen auswuchs. Griechenland, Spanien, Portugal, nach einiger Zeit auch Italien – die alten Disparitäten innerhalb der EU wurden offensichtlich verschärft. Konträre wirtschaftspolitische Vorstellungen, wie der Krise zu begegnen sei, führten rasch zum Streit zwischen EU-Kommission, Europäischer Zentralbank, Sparaposteln aus den Reihen der stärkeren EU-Staaten und in die Defensive gedrängten «Schuldnern ». Die einflussreiche deutsche Regierung, allen voran Merkel und Schäuble, behaupteten umstandslos zu wissen, worauf sie die ärmeren EU-Partner einschwören mussten: Wo Haushalte schwächeln, muss gespart werden. Mit Steuermitteln betriebene Bankenrettung auf der einen Seite und Austeritätspolitik auf der anderen Seite waren und sind weiterhin das Gebot der Stunde. Die EU-Kommission und die EZB machten sich diese Maxime ebenfalls zu eigen. Wer nicht spart, wird politisch unter Druck gesetzt und abgestraft – zuletzt war dies nach den «Anti-EU»-Wahlen in Griechenland deutlich zu beobachten (…)