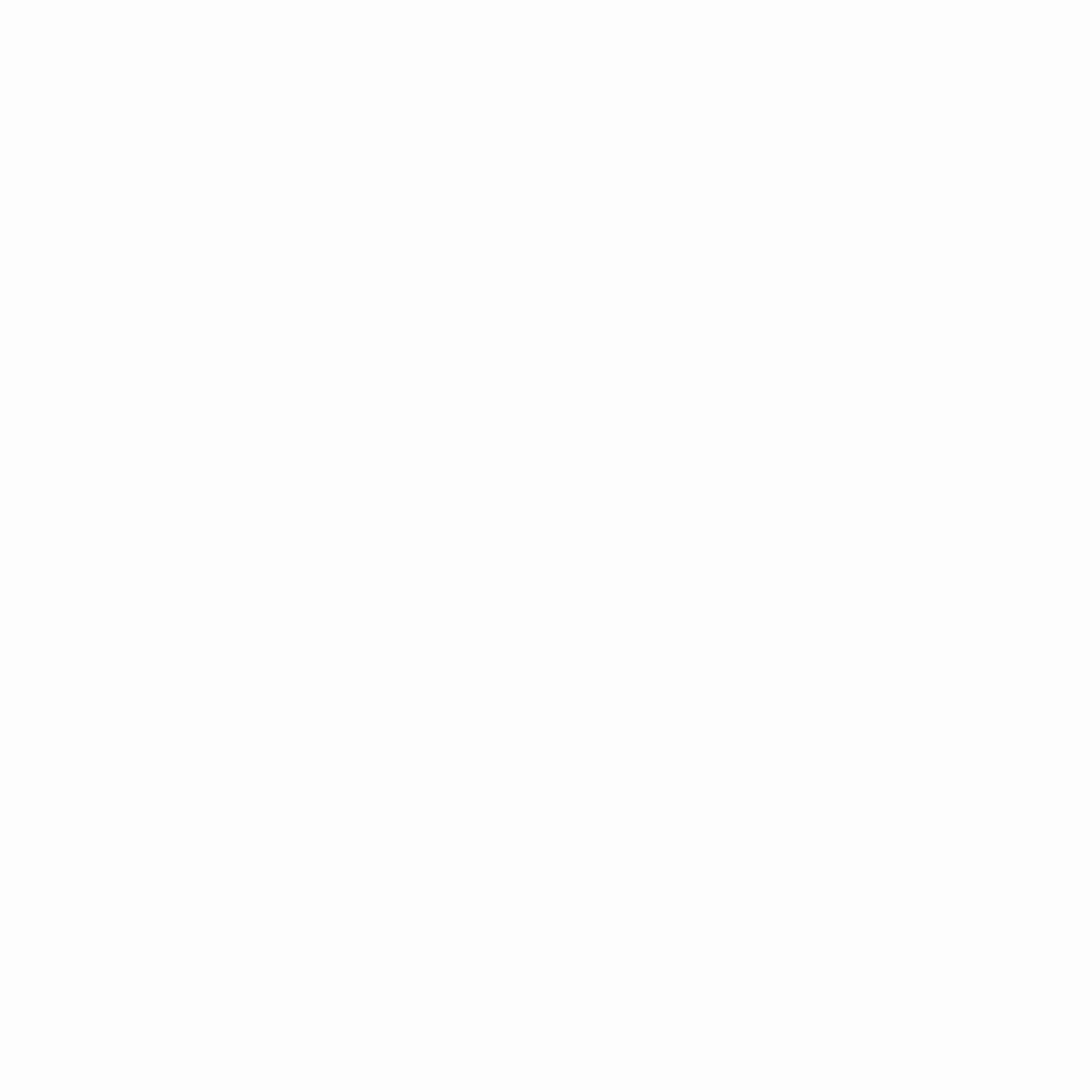Share This Article
Seit den Wahlerfolgen der Grünen vom 27. März wird geraunt und gemunkelt, ob die Grünen nun eine «Volkspartei» geworden oder wenigstens auf dem Weg dorthin vorangekommen seien. Die Frage ist als Ausgangspunkt für die Analyse nicht schlecht – allerdings muss der Begriff «Volkspartei» zunächst entideologisiert und präzise bestimmt werden.
«Volkspartei» ist, soweit ich es überblicke, erst durch die programmatische Neudefinition der SPD von 1959 in den deutschen politischen Diskurs eingeführt worden. Im Godesberger Programm heißt es im letzten Abschnitt unter dem Titel «Unser Weg»: «Die Sozialdemokratische Partei ist aus einer Partei der Arbeiterklasse zu einer Partei des Volkes geworden.» Begründet wird das damit, dass die Arbeiterbewegung sehr erfolgreich gewesen sei: «Soziale Sicherheit und die Demokratisierung der Wirtschaft» würden «in zunehmendem Maße verwirklicht». Die SPD folgte damals der Gesellschaftsbeschreibung des Soziologen Helmuth Schelsky, der die Klassengegensätze für überwunden erklärte und von einer «nivellierten Mittelstandsgesellschaft» schwärmte. (Dass das schon damals blühender Unsinn war, und dass Schelskys These heute durch die sich national und global öffnende Schere zwischen Kapitalbesitzern und Ausgebeuteten/Armen dramatisch widerlegt wird, sei hier zunächst nur am Rande vermerkt.)
Wer von «Volkspartei» sprach, auch als Wissenschaftler, leugnete damit also zugleich den Charakter der bundesdeutschen Gesellschaft als Klassengesellschaft. Im Übrigen ist dieser Begriffsgebrauch eine rein deutsche Angelegenheit: Wer «Volkspartei» wörtlich in andere Sprachen übersetzt, etwa «people’s party» oder «partito popolare», trifft auf völlig andere Parteien als die damit in Deutschland beschriebenen Großparteien CDU/CSU und SPD. Eine sachgerechte Übersetzung ins Englische hat der Politiktheoretiker Otto Kirchheimer geliefert: «Volkspartei» heißt bei ihm «Catch-all party». Das trifft dann tatsächlich auf viele Parteien zu und lässt sich auch vergleichend verwenden: für die Großparteien in den wahlrechtsgestützten Zweiparteiensystemen der USA, Großbritanniens und Australiens, Sozialdemokraten und Konservative in Deutschland und Österreich, skandinavische Sozialdemokraten und – frühere – italienische Christdemokraten, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen.
Was ist all diesen Catch-all parties gemeinsam?
- Sie richten politische Angebote an alle Gesellschaftsschichten.
- Sie bemühen sich um Kontakt zu und Berücksichtigung von allen organisationsfähigen gesellschaftlichen Interessen, vor allem: Kapital/Arbeitgeber, «Mittelstand», Gewerkschaften/Arbeitnehmer, Landwirte, Kirchen, Sozialverbände.
- Sie versuchen in ihren Programmen und Wahlmanifesten, und auch in ihrer Politik als Regierung oder parlamentarische Opposition, alle Politikfelder möglichst gleichmäßig abzudecken und sich auf diesen zu profilieren.
Anfangs, nachdem die SPD sich zur «Volkspartei» umdefiniert hatte, glaubten einige Kritiker, dass bei einem Wettbewerb von Catch-all parties die Unterschiede und Alternativen – und damit die Substanz demokratischer Wahlen als Ausdruck der Volkssouveränität – vollends verloren gingen. Die konkurrierenden Großparteien bedienen nur «die Mitte» und gleichen sich daher in Programmatik und Politik immer mehr einander an. Das ist auch oft geschehen, aber jedenfalls in Kontinentaleuropa, wo auch neue Parteien, die von den Rändern kommen, eine Wahlchance haben, ist das auch immer wieder durch eine Erweiterung des Parteiensystems ausgeglichen worden, so in (West-)Deutschland in den 80er Jahren durch die Grünen, in (Gesamt-)Deutschland seit 1990 durch PDS/Linkspartei.
In beiden Fällen wurden Interessen, Themen und auch Werte von den dominierenden Catch-all parties nicht hinreichend bedient: Beim ersten Mal die Ökologie und die AKW-Gefahren, beim zweiten Mal zunächst die Interessen der Ostdeutschen, später auch die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, angesichts der «Reformen» der Schröder-Fischer-Regierung, die einen Massenabsturz in den Niedriglohnsektor und eine dauerhafte, im europäischen Vergleich einmalige, Lohnstagnation samt Umverteilung nach oben bewirkten. Und, was die Linkspartei betrifft, auch in der Frage der Friedenspolitik. Die Grünen, die einmal als «Partei der Friedensbewegung» angetreten waren, haben auf diesem Gebiet ihre vermutete Kompetenz schon längst an die Linkspartei abgetreten.
«Volkspartei» – im Sinne von Catch-all party – zu werden, um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, wäre für die Grünen, auch wenn sie nun zum ersten Mal einen Landesregierungschef stellen, nicht nur ein Segen, sondern auch ein Problem. Sie müssten Generalkompetenz mit Profilierung spezifischer Kompetenz in Einklang bringen. Und für die Demokratie in Deutschland wäre es nicht förderlich, wenn die Wähler nun schon zwischen drei Parteien Unterschiede herausfinden müssten, die diese Parteien selber, weil sie alle in der Mitte stehen wollen, den Wählern nicht offenbaren.
Sollen, Wollen, Können
Nach diesen Vorbemerkungen lässt sich die Frage genauer stellen: (1) Sollen, (2) wollen und (3) können die Grünen eine Catch-all party werden?
Zum ersten: Das Sollen folgt Wünschen und normativen Ansprüchen des Kritikers. Ich meine: Demokratie fördernd wäre es nicht, wenn neben SPD und CDU/CSU nun schon ein dritter Anwärter auf die ganz große Harmonie (Hu Jintao lässt grüßen) auf den Plan träte. Aber, solange die dann Großen Drei (G3) der bundesdeutschen Politik nicht auch noch ein Wahlrecht oktroyieren, das alle Konkurrenten ausschließt, etwa 10%-Klausel oder so1, bin ich sicher, dass sich dann von links eine Konkurrenz auftäte, und außerdem gäbe es auch mehr Bürgerbewegung des Protests, mehr außerparlamentarische Opposition, die – nicht allein, aber auch – durch die Drohung, sich notfalls an Wahlen zu beteiligen, die Regierungspolitik, wer immer auch regiert, zu beeinflussen vermöchte.
Die zweite Frage nach dem Wollen der Grünen, eine «Volkspartei» zu werden, ist durch Empirie und Beobachtung leicht zu beantworten. Und zwar eindeutig: Ja, sie wollen, und wie sie wollen! Dafür steht exemplarisch Winfried Kretschmann. Er wird der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland. Nach dem Wahlerfolg vom 27. März 2011 betonten er und viele Journalisten sofort, dass die Grünen im «Ländle» wertkonservativ, bürgerlich und um gesellschaftliche Harmonie bemüht seien. Stolz definiert sich Kretschmann als «in der Mitte der Gesellschaft» befindlich, und in seinen Ankündigungen legt er besonderen Wert darauf, die neuen Wähler der Grünen – und die kamen von Nichtwählern, von CDU und FDP, und nicht hauptsächlich von der SPD – zu vertreten und einzubeziehen. Winfried Kretschmann ist, das wird ihm auch von wohlwollenden Talkshow-Diskutanten wie den Politik-Senioren Bernhard Vogel, Egon Bahr und Gerhart Baum attestiert, einer, der das Zeug zum schwäbischen Landesvater hat. Kretschmann und seine grüne Landespartei haben sich – neben ihrem Hauptthema Atomenergie und Umwelt – thematisch auch noch auf Bildung, ein früher einmal eher linkes, aber eigentlich auch schon konsensuales Thema, und auf Haushaltskonsolidierung, und das ist ein eindeutig neoliberales Thema, fokussiert.
Im Übrigen ist Winfried Kretschmann auch als Person die ideale Verkörperung der «Mitte»: Grüner, Katholik, Oberstudienrat, Familienvater, Sänger im Kirchenchor etc. – aber dann doch auch irgendwann einmal als Student Mitglied im KBW, einer maoistischen Parteiorganisation der 70er Jahre, aber das wird ihm in den bürgerlichen Kreisen des Ländle gern verziehen. Die Söhnle habet sich ja irgendwann mal austobe müsse, bevor se gscheit gworn sind.
Die dritte Frage nach dem Können ist ebenso eindeutig beantwortbar: Die Grünen können sich derzeit nicht als Catch-all party präsentieren. Ihre Fähigkeit dazu nimmt sogar mit steigenden Wählerzahlen und Regierungsämtern ab. Diese These bedarf einer ausführlicheren Begründung.
Beginnen wir mit den Wahlen vom 27. März 2011, bei der die Grünen in Baden-Württemberg zum ersten Mal mehr Stimmen als die SPD erhielten und sich für die Regierungsführung qualifizierten. Für die Catch-all-These spricht, dass Wähler aus allen Lagern zu ihnen geströmt sind, nicht einmal hauptsächlich von der SPD. Andererseits spricht viel dafür, dass die Grünen an diesem Tag, während die japanische Atomkatastrophe im wörtlichen Sinn am Kochen war, vor allem deshalb nach oben schnellten, weil ihnen in Sachen Gegnerschaft zur Atomenergie die meiste Kompetenz und Glaubwürdigkeit zugeschrieben wurde. Dabei ist Glaubwürdigkeit durchaus etwas Relatives. Wer genauer hinsieht, wie Jutta Ditfurth (2011), findet gute Gründe für den Zweifel daran, dass die Grünen immer für den frühestmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie eingetreten sind. Unter der Schröder-Regierung stimmten sie im Jahr 2000 einem Kompromiss zu, der zwar das Ziel des Ausstiegs festschrieb, aber den Betreiberinteressen bei den Laufzeiten weiter entgegen kam, als es seit kurzem auch der Umweltminister Röttgen von der CDU möchte.
Gleichwohl behält das Argument Gewicht, dass damals mehr nicht durchzusetzen war. Und vor allem im Vergleich zu den Regierungsparteien, die entgegen ihrer Politik von vor einem halben Jahr nun hektisch ein «Moratorium der Laufzeitverlängerung» ausriefen, aber auch im Vergleich zur SPD, die früher die Atomenergie gefördert hatte, erschienen die Grünen auf dem Gebiet der Atompolitik geradezu lupenrein glaubwürdig. Insofern verdanken die Grünen ihren Wahlerfolg eher ihrem Charakter als «Ein-Punkt-Partei» denn ihrer Profilierung auf vielen Feldern, wie es sich für eine Catch-all party gehören würde. Allenfalls lässt sich sagen, dass die Grünen auf den anderen Feldern einfach Mainstream-Positionen – Bildung ist wichtig, Staatsschulden sind abzubauen – einnahmen und daher von der Konkurrenz nicht mehr als Bürgerschreck dargestellt werden konnten.
Hinsichtlich der Sozialstruktur ihrer Anhänger sind die Grünen einseitiger und elitärer geworden. Dies zeigt das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (Kroh/Schupp 2011). Dieses Panel misst soziale Lagen und politische Einstellungen seit 27 Jahren, und es fragt nach längerfristigen Parteibindungen. Es zeigt sich, dass die Grünen tatsächlich eine solide Stammwählerschaft haben – unter den nach 1960 geborenen sind es 18%, und die bleiben auch dabei, wenn sie älter werden. Der demografische Wandel nützt den Grünen also langfristig, sofern sie es weiterhin vermögen, Jungwähler zu gewinnen. Verblüffend ist, dass bei den an die Grüne Partei Gebundenen exakt dieselben sozialen Merkmale dominieren wie bei der FDP: Es gibt überproportional viele Besserverdienende, Beamte, Angestellte und Selbstständige. Im Übrigen haben fast alle Abitur. Arbeitslose, Arbeiter, untere Angestellte sind unterrepräsentiert. Und hier hat sich durchaus etwas geändert während des Marsches der Grünen in die «Mitte»: In den 80er Jahren lag die Anhängerschaft der Grünen im unteren Einkommensfünftel der Bevölkerung noch bei 9%, die im oberen Fünftel ebenso bei 9%. 2010 aber ist der Anteil im oberen Fünftel auf 16% gestiegen, der im unteren auf 6% gesunken. Sozial sind die Grünen also eine Partei der Aufsteiger, der inzwischen Angekommenen, Etablierten. Ist das die «Mitte der Gesellschaft»?
Die Ausklammerung des Sozialen
Wer sagt, dass sie damit «Volkspartei» geworden sind, bedient, genau wie vor 50 Jahren, eine Ideologie der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, nach der es Klassen, Klassengegensätze und darüber hinaus von Profitinteressen ausgehende Bedrohungen der Lebensgrundlagen aller Menschen nicht mehr gebe. In Wirklichkeit ist die soziale Spaltung zwischen Reich und Arm, Unten und Oben, Vermögensbesitzern und Lohnabhängigen, Gesicherten und Prekären in der deutschen Gesellschaft erheblich gewachsen, wie alle Untersuchungen, welche Kriterien und Messinstrumente auch immer verwendet werden, bestätigen. Und gesichert ist auch, dass dies durch die sieben Jahre der rot-grünen Bundesregierung 1998–2005 zielgerichtet befördert wurde: Steuerpolitik für Reiche, Installation eines riesigen Niedriglohnsektors durch «Agenda 2010»/Hartz IV, drastischer Abbau sozialer Leistungen, Aufhebung der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer etc. Die SPD wurde bei den nachfolgenden Wahlen ab 2000 nicht zu knapp für diesen Verrat an ihrer ursprünglichen Klientel bestraft. Bis heute weiß sie nicht, wie weit sie zurückrudern will; die Flügelkämpfe zwischen der gut organisierten und dominanten Gruppe, die stolz ist, dass die SPD «die bessere Wirtschaftspartei» (Olaf Scholz) ist, und denen, die klassische Traditionen wieder beleben möchten, gehen weiter. Die SPD hat unter der Regierung der Wirtschaftslobbyisten Schröder und Clement ein solches Ausmaß an Verlust der Glaubwürdigkeit erlitten, dass es noch Jahre dauern wird, bis dieses Leck gestopft ist. Aber die Grünen, die diese gesamte Anti-Sozialpolitik der Schröder-Fischer-Regierung mitgemacht und mitgetragen haben, die schaffen es, völlig ohne blaues Auge daraus hervorzukommen? Niemand wirft ihnen vor, eine Mitschuld daran zu haben, dass es Millionen Menschen schlechter geht und weniger Reiche immer reicher werden. Und das, obwohl sie die gesamte «Agenda 2010»-Politik und die Steuer«entlastungs»politik, wegen der Lafontaine als Finanzminister und SPD-Vorsitzender schon 1999 zurückgetreten ist, fast vorbehaltlos, neoliberale Parolen nachbetend, und nicht etwa zähneknirschend, unterstützt haben.
Wie haben sie es geschafft, sich aus ihrer Mitverantwortung für den größten Sozialabbau der deutschen Geschichte seit Brüning davonzustehlen? Man ist ja versucht, an Zauberei, an Taschenspielertricks zu glauben. Immerhin war diese Partei bei ihrer Gründung, da hatte sie noch kein Grundsatzprogramm, einmal mit dem Bekenntnis zu «vier Säulen» angetreten: Ökologisch – Basisdemokratisch – Sozial – Gewaltfrei. Wie konnte diese Partei das Soziale so aus sich selbst herausoperieren, dass es niemand merkte, und dass ihr das heute auch kaum noch jemand übel nimmt?
Ich folge hier weitgehend Jutta Ditfurth in der Beschreibung des «Sozialverrats» der Grünen. Sie liefert in ihrem neuesten Buch überzeugende Beispiele dafür, wie sehr die Grünen bereit waren, die Schröder-Politik mitzumachen und wie hilflos damals die wenigen Linken wie Ströbele und Hermann gegen den innergrünen neoliberalen Mainstream anzuschwimmen versuchten und dann doch zustimmten (2011: 225). Aber auf die Frage, wie die Grünen sich, anders als die SPD, aus der Verantwortung, und damit auch aus der Bestrafung, für ihre Mitwirkung an dieser Politik haben davon schleichen können, finde ich auch bei Jutta Ditfurth keine überzeugende Antwort. Manipulation durch Medien und deren Themenherrschaft erklärt manches, aber doch nicht alles. Gewiss war die Säule «Sozial» bei den Grünen real immer ziemlich dünn und schwach – aber in Gründungszeiten und im ersten Jahrzehnt gab es Gewerkschafter, wie Rainer Trampert, und es gab auch Quellorganisationen wie die Alternativen Listen in den großen Städten, in denen Hausbesetzer und Arbeitsloseninitiativen präsent waren. Heute ist dieser AL-Stamm der Grünen gründlich trockengelegt und entsorgt. Ditfurths Haupterklärung lautet, angelehnt an neuere Befunde des Bielefelder Sozialforschers Wilhelm Heitmeyer, dessen Institut jährlich Umfragen zur «Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit» (GMF) in Deutschland macht, wonach «vor allem das besserverdienende Bürgertum sozial verächtlich reagiert», dass diese Haltung auch für das bei den Grünen versammelte Bürgertum gilt. «Bei den Grünen ist es sehr verbreitet, die soziale Frage einfach nicht zu thematisieren und die Betroffenen aus der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion auszuschließen, sie zu vergessen, in der Annahme, dass die Opfer zu schwach und zu schlecht organisiert sind, um sich zu wehren» (Ditfurth 2011: 253).
Die deutsche Partei
Ich möchte noch einen spekulativen Erklärungsansatz für das derzeitige Wahl- und Umfragenhoch der Grünen hinzufügen. Im Berliner Tagesspiegel nannte ein Kommentator die Grünen «die deutscheste aller Parteien». Damit war gemeint, dass der Wunsch nach Harmonie unter den Parteien in Deutschland besonders groß sei. «Das ist nicht nur Folge identitätsloser Parteien, sondern auch die Reaktion der Parteien auf eine Bevölkerung, die ein unterschiedliches Politikangebot als beunruhigend wahrnimmt» (Schuller 2011). Ja, das finde ich richtig, aber auch noch unterkomplex. Ich fange jetzt an, reine Hypothesen zu spinnen, samt impliziten Befürchtungen und Selbstberuhigungen. Ich vermute folgendes:
- Deutsche Wähler/innen wünschen sich zugleich Demokratie und Harmonie.
- Deutsche Wähler/innen haben in der Schule gelernt, dass Demokratie nur geht, wenn es über Alternativen zu entscheiden gilt, aber sie haben auch in der Schule gelernt, dass die Wissenschaft immer recht hat, deshalb glauben sie gerne irgendwelchen Experten-und Sachverständigenräten, die z. B. beweisen, dass bei uns die Löhne zu hoch – oder auch zu niedrig – sind, statt sich auf ihre eigene Kompetenz und Erfahrung zu verlassen.
- Mithin glauben deutsche Wähler/innen, dass es für fast alle politischen Fragen wissenschaftlich «richtige» Lösungen gibt – woraus logisch folgt, dass eigentlich die Wissenschaftler und nicht sie selber als Bürger entscheiden sollten.
- Deutsche Wählerinnen und Wähler wollen nur das Gute, und zwar alles gleichzeitig: Stabile Währung, wirtschaftliches Wachstum, Erhaltung menschenwürdiger Umweltbedingungen, soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, mehr öffentliche Dienstleistungen vor allem bei Bildung/Wissenschaft, Gesundheit, Pflege; aber auch mehr Privatisierung, weil die Privaten viel effektiver sind als der bürokratische Staat.
- Deshalb geben deutsche Wählerinnen und Wähler den Parteien, die ihnen alles gleichzeitig versprechen, einen hohen Vertrauensvorschuss.
- Deutsche Wählerinnen und Wähler wollen das Gute nur für Deutsche, vielleicht noch für alle, die hier wohnen, auch wenn sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber schon die anderen Europäer werden nicht als zur eigenen Gruppe hinzu gerechnet, die übrigen Menschen auf der Welt schon mal gar nicht.
- Deutsche Wählerinnen und Wähler wollen deshalb aber keineswegs als rassistisch oder nationalistisch gelten – schon weil das der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft schaden würde.
Kurzum: Deutsche Wähler wünschen sich also am liebsten programmatisch eine Einheitspartei aus CDU/CSU/GR/FDP/SPD/LP/NPD. Die soll dann aber auch demokratisch sein. Das heißt: Die Grünen würden derzeit niemals aus dem Dschungelcamp gekippt. Sie sind die totale Mitte in dieser Konkurrenzgesellschaft. Irgendwie sind die Grünen jetzt ziemlich krass in dieser gewünschten Mitte, die «demokratisch» ohne Grundsatzstreit auskommen sein soll, angekommen, ja sie verkörpern diesen Wunsch derzeit am besten. Gewiss, es gab schon Schlimmeres in der deutschen Geschichte. Der NS-Faschismus kam auch aus der Mitte der Gesellschaft, und er brachte das Harmoniebedürfnis der Deutschen auf eine zu Winfried Kretschmanns Dialog-Politik entgegengesetzte Weise auf den Punkt. Vielleicht ist der 27. März 2011 ja für Deutschland tatsächlich ein Ausgangspunkt für die Erfindung einer anderen «Mitte» als je zuvor. Gleichwohl: Unter der Dominanz von Realos wie Kretschmann wie unter dem Durchmarsch des Wirtschaftsflügels in der SPD wurde öffentlich vergessen gemacht, was das politische Hauptproblem bleibt: Wir leben, in Deutschland, in Europa, und weltweit, in einer Klassengesellschaft, und wir müssen einem Kapitalismus, der unsere Überlebenschancen weltweit noch viel mehr bedroht, als es die Kernschmelzen von Fukushima tun, solidarisch entgegenzutreten in der Lage sein.
Kretschmanns Regierung sei Glück und vor allem Lernfähigkeit gewünscht, dazu ist dieser nette Mensch und gelernte Lehrer ja wohl in der Lage. Und der Linkspartei bleibt, wenn sie langsam mal lernt, Torheiten zu vermeiden, bei all diesen um die Mitte buhlenden Parteien ein fontanehaft weites offenes Feld für Themen wie soziale Gerechtigkeit und Frieden. Wie sagte einst August Bebel? «In der Mitte ist der Sumpf!»
Anmerkung
1. Was heute kaum noch jemand weiß: Die erste Große Koalition der Bundesrepublik Deutschland, unter dem Kanzler Kurt-Georg Kiesinger und dem Außenminister und Vizekanzler Willy Brandt, 1966–1969, hatte sich auch eine radikale Wahlrechtsänderung ins Programm geschrieben. Allen Ernstes wollte sie das angelsächsische Mehrheitswahlrecht einführen. Dabei kommt nur der ins Parlament, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen gewinnt. Das Ergebnis ist also völlig unabhängig von den landesweiten Stimmanteilen der Parteien, und die zwei größten Parteien haben einen ungeheuren «Wettbewerbsvorteil» gegenüber kleineren und neuen Parteien, es sei denn, diese würden sich lokale Hochburgen schaffen. Hätte solch ein Wahlrecht etwa 2011 in Baden-Württemberg gegolten, dann hätte die CDU rund 80% der Sitze gewonnen.
Ein solches, zum Zweiparteiensystem drängendes Wahlrecht wollten 1966 bis 1969 CDU/CSU und SPD. Das Ganze scheiterte an den Wiederwahlinteressen der Abgeordneten, und auch an dem völlig berechtigten Aufschrei der damals einzigen Oppositionspartei FDP. Bundesinnenminister Paul Lücke, der mit seinem Herzblut an dem Projekt Wahlrechtsreform zwecks Zweiparteien-Mitte-Monopol hing, trat 1968 aus Enttäuschung zurück.
Literatur
Ditfurth, Jutta (2011): Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: Die Grünen. Berlin: Rotbuch.
Kroh, Martin und Schupp, Jürgen (2011): Bündnis 90/Die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei? Wochenbericht des DIW Berlin 12: S.3–9. Schuller, Moritz (2011): Ganz bei sich, Tagesspiegel, 31. 3.: S. 8.