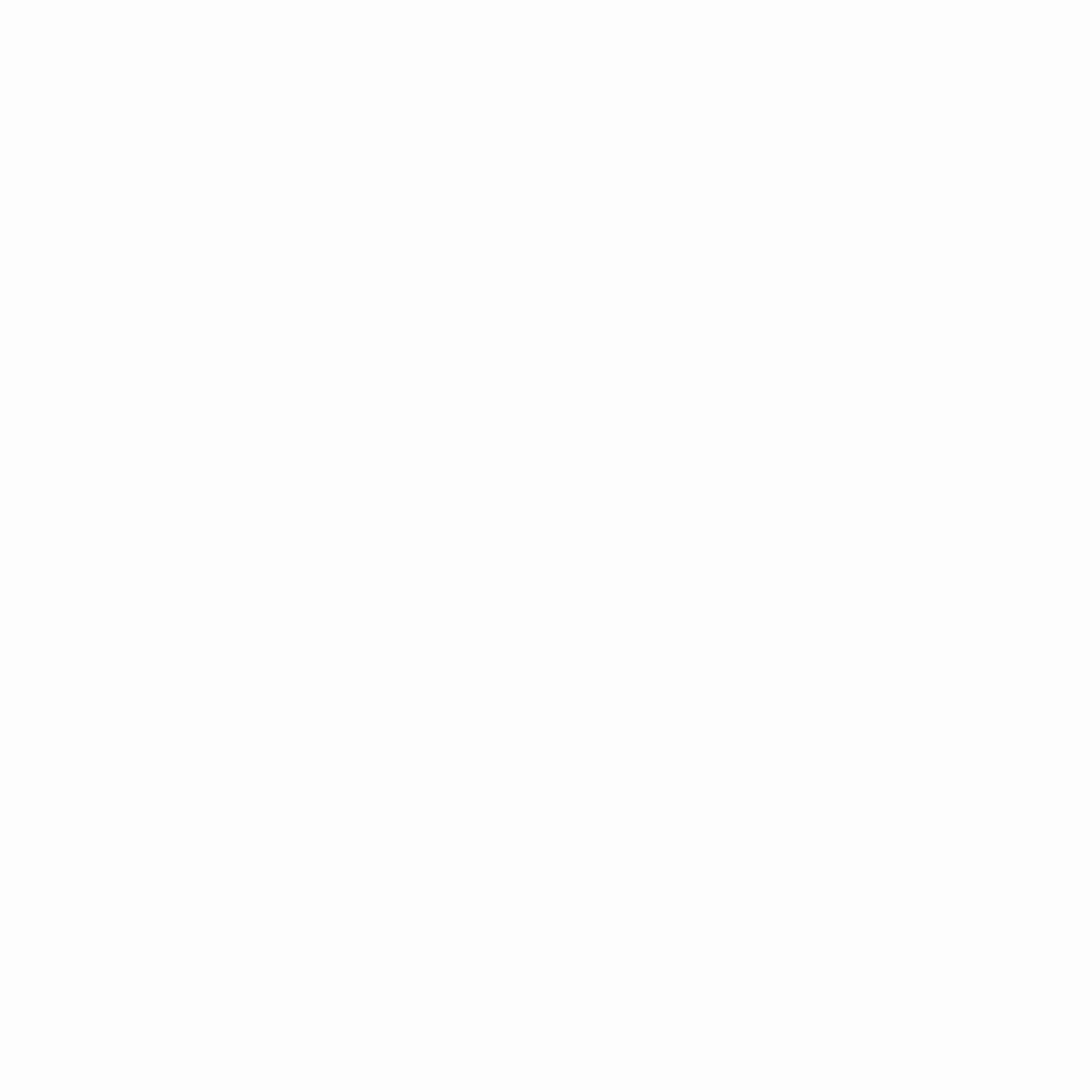Share This Article
Über die nichtjüdische Minderheit der israelischen Araber:innen wissen wir erstaunlich wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie 20 % der israelischen Staatsbürger:innen ausmachen. In dem Roman „Der Peptimist” von Emil Habibi, der sich mit ihrer tragischen Situation auseinandersetzt, gibt es eine vielsagende Stelle. Der arglos-naive Erzähler Said der Glücklose berichtet darin von seiner Einweisung ins israelische Schatta-Gefängnis: „Je weiter [der Wärter] in seiner Einweisung fortschritt, desto deutlicher wurde mir, dass zwischen dem, was man von uns im Gefängnis fordert, und dem, was man von uns außerhalb desselben fordert, überhaupt kein Unterschied besteht, sodass ich freudig überrascht ausrief: ‚Ma scha Allah! – Was Gott in seinem Willen doch alles fügt!“ Auch wenn Habibi für seine Abrechnung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen die Form der Satire wählte, kommt diese der Realität doch erschreckend nahe. Zu diesem Schluss gelangt man zumindest, wenn man Ilan Pappes „Geschichte der Palästinenser in Israel“ liest. Das Buch ist bereits 2013 auf Englisch erschienen und liegt nun endlich in deutscher Übersetzung vor. Es handelt von den Araber:innen in Israel, also von denen, die dort blieben und „aus der Asche ihrer Katastrophe heraus ihr Leben aufbauten“. Diese palästinensischen Israelis, wie sie sich selbst oft bezeichnen, sind die mit Abstand größte Minderheit in Israel, doch ihr Schicksal spielt in gängigen Betrachtungen des Konflikts meist keine Rolle. Dies gilt interessanterweise sowohl für palästinensische als auch für israelische Darstellungen. Bereits Pappes Buchtitel „Die vergessenen Palästinenser“ bringt dies auf den Punkt.
Ilan Pappe ist israelisch-britischer Historiker und Professor an der Universität Exeter. Er zählt zu den „revisionistischen israelischen Historiker:innen“, die seit Ende der 1980er Jahre die gängige zionistische Version der Ursprünge und Ursachen des arabisch-israelischen Konflikts infrage stellen. Sein wohl bekanntestes Buch „Die ethnische Säuberung Palästinas“ (englische Originalausgabe 2006, deutsche Übersetzung 2007) behandelt die Nakba, die „planmäßige Vertreibung“ der einheimischen arabischen Bevölkerung Ende der 1940er Jahre. Allerdings war die Vertreibung damals nicht vollständig. Von den rund eine Million Palästinenser:innen, die in dem Gebiet lebten, das zum Staat Israel wurde, blieben im Jahr 1949 etwa 160 000 zurück. Ihrer Geschichte widmet sich Pappe in „Die vergessenen Palästinenser“. Das Buch ist chronologisch aufgebaut und bietet zwei Perspektiven: die der Entscheidungsträger:innen des Staates Israel und die der israelisch-palästinensischen Gemeinschaft. Der Schwerpunkt liegt bei der Betrachtung der „Geschichte der Palästinenser in Israel“. Besonders ins Gewicht fällt dabei das erste Jahrzehnt der Existenz Israels, in welchem „die grundlegenden Parameter für das staatliche Verhalten gegenüber seiner palästinensischen Minderheit formuliert und fixiert wurden“. In der israelischen Unabhängigkeitserklärung vom Mai 1948 wurde allen Bürger:innen gleiche Rechte versprochen. Aber waren damit wirklich alle Bürger:innen gemeint? Gegen einen Treueeid auf den jüdischen Staat bekamen auch die verbliebenen nichtjüdischen Araber:innen die israelische Staatsbürgerschaft verliehen. Diese war allerdings, wie Pappe beschreibt, „kein gesetzlicher Anspruch, sondern ein Privileg“. Zeitgleich wurde über diese Gruppe für fast zwei Jahrzehnte eine strikte Militärherrschaft mit Bewegungseinschränkungen und willkürlichen Haftstrafen verhängt, deren Ziel darin bestand, dass sie „freiwillig” das Land verlassen sollten. Doch genau dies geschah nicht. „Ihre Standhaftigkeit und hartnäckige Entschlossenheit, den israelischen Taktiken nicht zum Opfer zu fallen, ist ein Kapitel Heldentum, nicht Defätismus“, so Pappe. 1966 wurde die Militärherrschaft schließlich aufgegeben. Allerdings wurden im Junikrieg 1967 das Westjordanland und der Gazastreifen von Israel besetzt und jetzt lebten die Palästinenser:innen dort faktisch unter einer Militärherrschaft. Seither muss zwischen den staatenlosen Palästinenser:innen in den besetzten Gebieten, die keinerlei Rechte haben, und den Palästinenser:innen in Israel, die zwar Bürger:innen des Staates sind, denen aber trotzdem grundlegende Menschen- und Bürger:innenrechte verweigert werden, unterschieden werden. So sehr sich diese beiden Gruppen auch einander zugehörig fühlen und ein gemeinsames Nationalbewusstsein entwickelten, so sehr unterscheiden sich ihre politischen Kämpfe und Forderungen seit jeher. „Die politische Bewegung im Westjordanland und im Gazastreifen konzentrierte sich auf die Befreiung von der israelischen Besatzung. Die Palästinenser in Israel unterstützten dies zwar, betonten jedoch als ihre Priorität den Kampf für Gleichberechtigung innerhalb des jüdischen Staates“, so Pappe. Diese Gleichberechtigung dreht sich vor allem um die Frage der Staatsbürgerschaft, und zwar uneingeschränkt und unbedingt sowie um Landrechte. „Die Grundrechte wie das Wahlrecht, das Recht, wählbar zu sein, die Meinungs-, Freizügigkeits- und Vereinigungsfreiheit sind vorhanden, aber sie werden alle mit nur einer, und zwar der überlegenen ethnischen Gruppe identifiziert. Diese Grundrechte werden nicht durch die Herrschaft der Mehrheit, sondern von einer Ethnie zur anderen gewährt.“ Wie sehr dies zutrifft, bestätigt sich traurigerweise an den Entwicklungen der letzten Jahre, in denen Grundrechte Stück um Stück zurückgenommen werden. Mittlerweile kann man ohne Gerichtsurteil im Gefängnis landen oder seinen Job verlieren, wenn man – etwa in den sozialen Medien – Mitgefühl für die Palästinenser:innen in Gaza zeigt. Grundlage dafür sind die Segregation und Diskriminierung der vergangenen Jahrzehnte, die Pappe bildhaft als „Matrix aus Wänden und gläsernen Decken“ beschreibt. Wenn Pappe im Nachwort des Buches Israel als „Unterdrückungsstaat“ definiert, dann meint er explizit die Beziehung des Staates zu seiner palästinensischen Minderheit. Diese hat drastische gesellschaftliche Auswirkungen. So sind in Israel die Hälfte der Familien unterhalb der Armutsgrenze palästinensisch.
Beim Verfassen der Schrift vor fast 15 Jahren hatte Pappe zwei gegensätzliche Entwicklungstendenzen ausgemacht. Einerseits beschrieb er die israelischen Palästinenser:innen als eine stolze nationale Minderheit, die eine einzigartige palästinensische Identität entwickelt hat. Auch wenn ihnen „grundlegende kollektive und individuelle Menschen- und Bürgerrechte verweigert werden“, so sind sie doch die einzige palästinensische Gruppe, die die Israelis nicht nur als Soldat:innen oder Siedler:innen kennt. Insofern könnten sie eine Brücke schlagen: „Wir sind die Palästinenser, die trotz allem eure Anwesenheit in unserem Heimatland akzeptiert haben.“ Diese Tendenz zeigt sich deutlich in ihrer gesprochenen Sprache, die Arabrabiya genannt wird. Ein eigener palästinensisch-israelischer Dialekt des Arabischen, der mit hebräischen Wörtern verwoben ist. Pappe stellt dieser hoffnungsvollen Tendenz dann allerdings den israelischen Mainstreamdiskurs der „demografischen Gefahr“ entgegen, der deutlich macht, dass die Palästinenser:innen in Israel eher als ausländische Agent:innen denn als Teil der eigenen Gesellschaft gesehen werden. Da die Geburtenrate der palästinensischen Israelis höher ist als die der jüdischen Israelis, sprechen Medien und Politik offen davon, dass jedes neugeborene palästinensische Baby „eine ernsthafte nationale Gefahr für die Existenz des Staates darstellt“. Schon damals dominierte laut Pappe diese unheilvolle Seite der Entwicklung. Er diagnostizierte, dass der jüdische Staat die Farce der Demokratie aufgegeben habe, weil er es leid sei, weiter herumzulavieren. Infolgedessen habe er seine Unterdrückung der Minderheit auf eine noch nie dagewesene Weise verschärft. Diese Prognose hat sich leider vollkommen bestätigt. Jetzt, wo in den besetzten Gebieten die ethnische Säuberung proklamiert und in genozidaler Form durchgesetzt wird, verschlechtert sich auch die Lage der Palästinenser:innen in Israel. Doch so dramatisch die aktuelle Situation auch ist, so sehr lohnt sich ein Blick die Geschichte. Wenn es jemals zu einer arabisch-israelischen Verständigung „frei von Apartheid, Fanatismus und Rassismus“ kommen soll, müsste den palästinensischen Israelis eine Schlüsselrolle zukommen. Trotz aller Schwierigkeiten manifestiert ihr Schicksal faktisch einen komplett anderen Zugang zur gesamten Palästina-Frage. So unwahrscheinlich und unvorstellbar dies angesichts der Bilder aus Gaza derzeit auch erscheinen mag, letztlich gibt es keine andere emanzipatorische Perspektive als „zwischen dem Fluss und dem Meer eine echte Demokratie für alle zu schaffen“, so Pappe in einer aktuell verfassten Einleitung des Buches. Gerade für diese Perspektive ist die Beschäftigung mit der Geschichte der „vergessenen Palästinenser“ von so unschätzbarer Wichtigkeit.